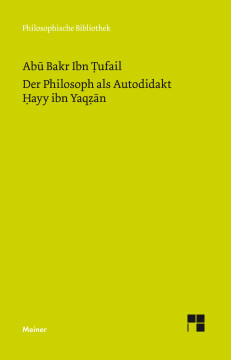
BUCH
Der Philosoph als Autodidakt. Hayy ibn Yaqzan
Ein philosophischer Insel-Roman
Herausgeber: Schaerer, Patric O.
Philosophische Bibliothek, Bd. 558
2019
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Ziel dieses philosophisch-allegorischen Inselromans des arabisch-andalusischen Denkers Ibn Tufail ist die Verteidigung der Philosophie als rationale Form der Erkenntnis. Ibn Tufail antwortete damit auf die Angriffe al-Ghazalis, der die philosophische (aristotelische) Methodik bzw. deren Vereinbarkeit mit der Orthodoxie des Islam in Frage stellte. Entgegnet wird dieser Kritik im Hauptteil des Traktats, wo die rationale, der natürlichen Veranlagung des Menschen angemessene Struktur des philosophischen Wissenskanons aufgezeigt wird, und durch den Nachweis, dass philosophische Erkenntnis sehr wohl mit den Inhalten der Offenbarungsreligion übereinstimmt, viel besser sogar als die bloß symbolhafte Religion der breiten Masse. Zugleich wird aber die von al-Ghazali vollzogene Wendung hin zur Mystik aufgenommen, indem die unmittelbare, intuitive Erfahrung als Erkenntnisform etabliert und dem theoretischen Erfassen gleichgestellt, ja übergeordnet wird. Beide Wege, die der Philosophie und der Sufik, werden dabei miteinander verwoben. Für diese Einbindung der Sufik in die Philosophie wird die Autorität Ibn Sinas in Anspruch genommen, indem ihm unter dem Titel der »orientalischen Weisheit« eine esoterisch-sufische Lehre zugeschrieben wird. Große Beachtung fand der Traktat in den religionskritischen Debatten des 18. Jahrhunderts. Wiederentdeckt wurde er 1952 von Ernst Bloch, der in Ibn Tufails Traktat den Grundglauben der Aufklärung bestärkt sah, »dass der Mensch außer seiner Vernunft einen Glauben nicht brauche«.


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish