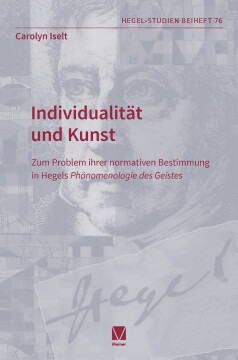
BUCH
Individualität und Kunst
Zum Problem ihrer normativen Bestimmung in Hegels »Phänomenologie des Geistes«
Hegel-Studien, Beihefte, Bd. 76
2024
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Anders als hinlänglich aus der Rezeption der Kunstphilosophievorlesungen Hegels bekannt weist Carolyn Iselt in ihrer Studie zur Kunst-Religion in der »Phänomenologie des Geistes« nach, dass dem menschlichen Individuum in der Kunst auch für Hegel nicht nur Bedeutung in idealisierter Form als Götterskulptur oder als tragischem Helden zukommt. Vielmehr dienen die klaren ästhetischen Formen dazu, das Unterdrücken der Individualität hervor- und diese ins Bewusstsein treten zu lassen. Im Kapitel Kunst-Religion ist demnach eine Entwicklung vom sittlichen-allgemeinen Bewusstsein hin zum Erkennen der Bedeutung des Einzelnen und dessen Individualität nachzuvollziehen, und zwar anhand einer systematischen Abfolge von Kunstgattungen – Skulptur, Gesang, Epos, Tragödie und Komödie. Daraus lässt sich auch für die Kunst ableiten, dass ein Hinausgehen über die ideale Einheit auch aus ästhetischen Gründen notwendig ist. Während dies den zweiten Teil der Arbeit bildet, zeigt die Autorin im ersten auf, dass sich am Ende des Vernunftabschnitts im Unterkapitel »Das geistige Thierreich und der Betrug, oder die Sache selbst« das allgemeine Bewusstsein des Geistes aus der Kritik an der dort dargestellten Vorstellung von absoluter Individualität entwickelt. Herausgearbeitet wird hier, dass Hegel Individualität überhaupt mit »Thun« gleichsetzt, sodass die jeweils besondere Bestimmung der Individualität erst aus einem im Tun entstehenden Wechselspiel zwischen angeborenen Eigenschaften und sozialer Wirklichkeit erfolgt. Aber nicht nur der Einzelne bestimmt und erfährt sich durch sein Handeln, auch die Gemeinschaft sowie deren Bewusstsein, der Geist, gründet im »Thun Aller«. Im geistigen Tierreich wird zwar diese Basis des Geistes – das Tun interagierender Individuen – en détail dargelegt, aber ein geistiges Bewusstsein tritt lediglich als Desiderat auf. Mithin fehlt es auch an einem Medium der Reflexion. Letzteres stellt den Zusammenhang zur Kunst bzw. zur Kunst-Religion her. Im Kunstwerk reflektiert sich nicht nur das Künstlerindividuum, sondern gleichfalls die soziale Wirklichkeit, durch die auch der Künstler bis in seine Individualität hinein bestimmt ist. Durch den Fokus auf die Kunst-Religion und das geistige Tierreich wird in dieser Studie der Zusammenhang zwischen individuellem Tun, dem Kollektiv handelnder Individuen und Kunst herausgestellt. Dabei wird ausgehend vom hegelschen Text sowohl die Vermittlung zwischen dem Einzelnen und der sittlichen Allgemeinheit als auch die substantielle Bestimmung der Kunst diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | U1 | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhalt | 7 | ||
| Dank | 11 | ||
| Einleitung | 13 | ||
| 1. Individualität und Kunst – das Problem ihrer (normativen) Bestimmung | 13 | ||
| 1.1 Skepsis an der definitorischen Bestimmung der Kunst | 13 | ||
| 1.2 Das Normative bei Hegel | 17 | ||
| 1.3 Das Klassische | 22 | ||
| 2. Zur Phänomenologie des Geistes | 29 | ||
| 2.1 Die Bewusstseinsgestalten | 31 | ||
| Das erscheinende Wissen und sein Maßstab | 31 | ||
| Skeptisches Prüfen und Erfahrung | 32 | ||
| Geistiges Bewusstsein und Wissenschaft | 34 | ||
| Zutat durch bestimmte Negation und Umkehrung | 37 | ||
| Darstellung und Kritik | 38 | ||
| 2.2 Knoten und Bund und andere Verhältnisse | 39 | ||
| Die Einheitlichkeit der Phänomenologie des Geistes | 39 | ||
| Programmatische allgemeine Reflexionen | 41 | ||
| 2.3 Systematik und Geschichte | 47 | ||
| 2.4 Das zugrunde gelegte Schema | 52 | ||
| 2.5 Substanz und Subjekt | 55 | ||
| 2.6 Überblick | 57 | ||
| TEIL I Das Hervorgehen des Allgemeinen aus dem Besonderen | 61 | ||
| 1. Die Entwicklung der Kategorie und der Individualität im Vernunftabschnitt | 63 | ||
| 1.1 Die Kategorie | 67 | ||
| 1.1.1 Vom Selbstbewusstsein zur Vernunft | 69 | ||
| 1.1.2 Die Einführung der Kategorie im Anschluss an Kant und Fichte | 72 | ||
| Kant | 76 | ||
| Fichte | 78 | ||
| 1.1.3 Konsequenzen der transzendentalen Kategorie | 90 | ||
| 1.1.4 Die Kategorie in der beobachtenden Vernunft | 93 | ||
| 1.1.5 Die Kategorie in der Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewusstseins durch sich selbst | 96 | ||
| 1.1.6 Die Kategorie in der Individualität, welche sich an und für sich selbst reell ist | 98 | ||
| 1.2 Die Individualität | 101 | ||
| 1.2.1 Die Verdinglichung der Individualität in der beobachtenden Vernunft | 102 | ||
| Die Individualität und das Organische in der Beobachtung der Natur | 105 | ||
| Das Verhältnis zwischen Individualität und Welt in der Beobachtung des Selbstbewusstseins | 111 | ||
| Die verknöcherte Individualität in der Beobachtung der Beziehung des Selbstbewusstseins auf seine unmittelbare Wirklichkeit | 113 | ||
| 1.2.2 Hegels Prinzip der Individualität | 118 | ||
| Die Lust und die Notwendigkeit und die reine, kreisende Individualität | 122 | ||
| Das Gesetz des Herzens und die verkehrende Übersetzung | 126 | ||
| Die Tugend und der Weltlauf und das Tun als Ansichsein der Individualität | 131 | ||
| 2. Das geistige Tierreich und der Betrug, oder die Sache selbst | 136 | ||
| Die Individualität als Kategorie | 136 | ||
| Inhaltliche und schematische Entwicklung der Individualität | 139 | ||
| Individualität als bloße Performativität – Probleme der Forschung | 140 | ||
| 2.1 Ursprüngliche Bestimmtheit der Natur – die subjektive individuelle Ebene | 146 | ||
| 2.1.1 Das Ansichsein der reinen Individualität | 147 | ||
| Selbstbewusstsein und Lebendiges – Kategorie und Individualität | 147 | ||
| Das logische Problem | 153 | ||
| Das Element der Individualität | 155 | ||
| 2.1.2 Das Tun der Individualität | 159 | ||
| Umstände, Interesse, Talent, Mittel, Werk oder die ganze Handlung | 161 | ||
| Modell I: Natürliches Talent, Genie und unendliche Kreativität des Performativen | 169 | ||
| 2.1.3 Das Werk als realisierte Bestimmtheit der Individualität | 172 | ||
| Handlung und Herstellung – Reines und Bestimmtes Tun | 172 | ||
| Das Werk als realisierte individuelle Bestimmtheit | 175 | ||
| Modell II: Die Individualität des Kunstwerks | 180 | ||
| 2.2 Die Wirklichkeit der Individualität und des Werks – die objektive Ebene | 182 | ||
| 2.2.1 Der Widerspruch des Werks | 183 | ||
| Die Bestimmtheit und das allgemeine Bewusstsein der Individualität | 184 | ||
| Das Element als Sein und Bewusstsein | 186 | ||
| Das Verschwinden der Individualität | 188 | ||
| Modell III: Rezeptive und objektive Bestimmung des Kunstwerks | 193 | ||
| 2.2.2 Das Selbstbewusstsein der Individualität | 194 | ||
| Der Gegensatz zwischen (Selbst-)Bewusstsein und Wirklichkeit | 195 | ||
| Das Auseinandertreten der Momente im bestimmten Tun | 197 | ||
| Aufhebung des Gegensatzes der Momente im reinen Tun | 199 | ||
| Das Selbstbewusstsein der Individualität – Übergang zur Sache selbst | 203 | ||
| Modell IV: Die Kunst als 'Sache selbst' und ihre substantielle Bedeutung | 209 | ||
| 2.3 Ehrlichkeit und Betrug, oder die Sache selbst – die absolute Ebene | 211 | ||
| 2.3.1 Die Kategorie als Ziel der Sache selbst | 211 | ||
| Weitere Unterkapiteleinteilung und Binnenstrukturen | 212 | ||
| Sinnliche Gewissheit und Wahrnehmung | 215 | ||
| 2.3.2 Die Ehrlichkeit | 222 | ||
| Begrifflich-logische und phänomenale Darstellung der Ehrlichkeit | 223 | ||
| Modell V: Vereinseitigung und Provokation | 227 | ||
| 2.3.3 Der Betrug | 228 | ||
| Begrifflich-logische Darstellung des Betrugs | 229 | ||
| Die phänomenale Darstellung des Betrugs | 232 | ||
| Modell VI: Urteil und Stempel – Kunstkritik | 235 | ||
| 2.3.4 Die Sache selbst als Subjekt und Kategorie | 237 | ||
| Normativität und Individualität | 237 | ||
| Von der Individualität zur Subjektivität | 240 | ||
| 2.3.5 Gesetzgebende und gesetzprüfende Vernunft – die 'Umkehrung' zum Geist | 246 | ||
| 3. Das sittliche Bewusstsein und das sittliche Tun | 252 | ||
| 3.1 Vernunft und Kategorie – Geist und Sittlichkeit | 254 | ||
| Tun, Handeln und die Sache selbst | 255 | ||
| Die Sittlichkeit als Sache selbst | 257 | ||
| 3.2 Bewusstsein und Handlung | 260 | ||
| 3.2.1 Das sittliche Bewusstsein | 264 | ||
| 3.2.2 Die sittliche Handlung | 273 | ||
| 3.2.3 Eine paradigmatische Darstellung der Sittlichkeit in der Tragödie? | 278 | ||
| Teil II Das Hervorgehen des Besonderen aus dem Allgemeinen – Die Kunstreligion | 281 | ||
| 1. Einleitendes – antike und romantische Kunstreligion | 283 | ||
| 1.1 Religion und Kunstreligion in der Phänomenologie des Geistes | 287 | ||
| 1.2 Das geistige Tierreich und die Kunstreligion | 290 | ||
| Drei Ebenen | 292 | ||
| 1.3 Die Kunstreligion und ihr Ende – Zur Forschungsdiskussion | 293 | ||
| 1.3.1 Die Fokussierung der positiven Bedeutung | 293 | ||
| 1.3.2 Die Fokussierung der negativen Entwicklung | 299 | ||
| 2. Der Übergang von der natürlichen zur Kunstreligion | 303 | ||
| Der Werkmeister als instinktartiger Arbeiter, der Künstler als geistiger Arbeiter | 303 | ||
| 2.1 Exkurs zur Arbeit in der Phänomenologie des Geistes | 304 | ||
| Die logische Struktur der Arbeit, Bewahren und Vergegenständlichen (1.) | 308 | ||
| Die Bildung des Bewusstseins (2.) | 309 | ||
| Theoretisch-praktische Bildung (3.) | 311 | ||
| Die existentielle Seite der Bildung (4.) | 312 | ||
| Die Realisierung des Selbstbewusstseins durch den Kampf auf Leben und Tod | 313 | ||
| Die Arbeit des bürgerlichen Herrn | 315 | ||
| 2.2 Instinktartiges Arbeiten | 321 | ||
| 2.2.1 Das Instinktartige als Prozess der Vergeistigung | 324 | ||
| Reflexion des Verhältnisses von Einzelnem und Allgemeinem | 325 | ||
| Selbstbewusstsein – Differenz und Kontinuität | 325 | ||
| Vermittlung von Geist und Natur | 326 | ||
| Die drei Ebenen und der Maßstab ihres Verhältnisses | 329 | ||
| Die Stufen des Instinktartigen | 329 | ||
| 2.2.2 Fünf Momente des instinktartigen Arbeitens | 331 | ||
| Das kunstvolle Artefakt (1.) | 332 | ||
| Reflexion der Substanz (2.) | 334 | ||
| Arbeit bildet (3.) | 337 | ||
| Aufgreifen vorangegangener, vor allem natürlicher Formen (4.) | 338 | ||
| Das bewusstlose Werk (5.) | 342 | ||
| 3. Der Bildhauer und die Skulptur – das abstrakte Kunstwerk | 345 | ||
| 3.1 Voraussetzungen des Künstlers | 345 | ||
| 3.1.1 Das Instinktartige im geistigen Arbeiter | 345 | ||
| 3.1.2 Das Verhältnis der Mythologie zur Kunst | 350 | ||
| 3.2 Das abstrakte Kunstwerk | 351 | ||
| Einleitendes | 351 | ||
| 3.2.1 Die subjektive Ebene: der Künstler | 352 | ||
| Das sittliche Tun der Bürger und die reine Tätigkeit des Künstlers | 353 | ||
| Die Individualität des sittlichen Bewusstseins | 362 | ||
| 3.2.2 Die objektive Ebene: das Werk und die Rezipienten | 365 | ||
| Absolutes und gewordenes Werk | 366 | ||
| Die verehrende Rezeption | 368 | ||
| Die negative Seite der Rezeption – Individualität, Kritik, Erfahrung | 371 | ||
| 3.2.3 Die absolute Ebene: das Darstellen der geistigen Substanz | 374 | ||
| Ästhetische Betrachtung der Skulptur – das Schöne | 375 | ||
| Hymne und Kult | 378 | ||
| 4. Der Rhapsode und das Epos – das geistige Kunstwerk I | 382 | ||
| 4.1 Die subjektive Ebene: der Dichter und der Sänger | 383 | ||
| Dichterisches Gestalten und mündliches Überliefern | 383 | ||
| Der Sänger | 386 | ||
| 4.2 Die objektive Ebene: die unschlüssige Schlussform des Epos | 387 | ||
| 4.3 Die absolute Ebene: die abstrakte Einheit und der konkrete Einzelne | 391 | ||
| 5. Der Schauspieler und seine Maske, Tragödie und Komödie – das geistige Kunstwerk II | 395 | ||
| 5.1 Die subjektive Ebene: Individualität, Schauspieler, Maske | 396 | ||
| 5.2 Die objektive Ebene: Sprache, Form und Wirkung | 398 | ||
| 5.2.1 Die allgemeine Sprache des Helden | 398 | ||
| 5.2.2 Die Form der Tragödie | 399 | ||
| Das Wissen des Charakters | 400 | ||
| Das Recht des Charakters | 404 | ||
| Das Nichtwissen | 406 | ||
| 5.2.3 Der Chor und die Wirkung der Tragödie | 411 | ||
| Das 'Jammern' und 'Schaudern' des Chores im Kontext von Aristoteles' Poetik | 415 | ||
| Das Zerfallen des Schauspielers | 421 | ||
| 5.3 Die absolute Ebene: die begriffene negative Einheit der Tragödie | 427 | ||
| Zur Komödie Überleitendes | 429 | ||
| 5.4 Der Schauspieler und seine Maske in der Komödie | 430 | ||
| 5.4.1 Die subjektive Ebene: die Ironie der Maske | 431 | ||
| Die individuelle Aneignung des Göttlichen durch das Natürliche | 434 | ||
| 5.4.2 Die objektive Ebene: Demos und verschwindender Dunst der Wolken | 439 | ||
| Vermittlung von Einzelnem und Allgemeinem, von Individualität und Sittlichkeit | 441 | ||
| Philosophische Dimension | 442 | ||
| 5.4.3 Die absolute Ebene: Schicksal, Individualität und Ende | 445 | ||
| Die Vereinigung der Nacht des Schicksals mit der abgeschiedenen Eumenide | 446 | ||
| Die Bestimmung des komischen Bewusstseins | 453 | ||
| Wesentliche Verbindung der Tragödie und Komödie | 454 | ||
| Die Ironie der Ironie | 457 | ||
| 6. Die Kunst nach der Kunstreligion | 458 | ||
| 6.1 Die Substanz als Prädikat oder als Subjekt | 459 | ||
| 6.2 Das durch die Kunst hervorgebrachte Bewusstsein der Individualität | 464 | ||
| 6.3 Erinnerung durch Kunst | 467 | ||
| Schluss | 474 | ||
| Versinnlichung des Geistes und Vergeistigung des Sinnlichen | 474 | ||
| Die Bedeutung der subjektiven, objektiven und absoluten Ebene für die Kunst | 479 | ||
| Individualität und Kunst | 481 | ||
| Literaturverzeichnis | 485 | ||
| Quellentexte | 485 | ||
| Sekundärliteratur | 488 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish