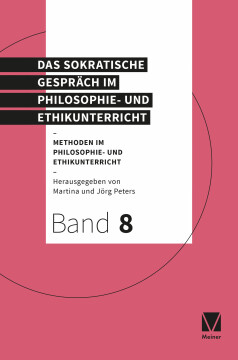
BUCH
Das Sokratische Gespräch im Philosophie- und Ethikunterricht
Herausgeber: Peters, Jörg | Peters, Martina
Methoden im Philosophie- und Ethikunterricht, Bd. 8
2025
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Das (Neo-)Sokratische Gespräch ist eine philosophische Unterrichtsmethode, die auf Leonard Nelson zurückgeht und von Gustav Heckmann weiterentwickelt wurde. Auch wenn die Methode namentlich an Sokrates anknüpft, unterscheidet sich diese Form der Unterredung insofern von der des antiken Philosophen, als die Untersuchungen von philosophischen oder ethischen Problemen bzw. Fragestellungen nicht im Zwiegespräch, sondern in moderierten Gruppengesprächen durchgeführt werden. Im Theorieteil des achten Bandes der Reihe »Methoden im Philosophie- und Ethikunterricht« werden die theoretischen Grundlagen, die Leonard Nelson und Gustav Heckmann in Bezug auf das Sokratische Gespräch entwickelt haben, vorgestellt. Im anschließenden Praxisteil zeigen wichtige Vertreter:innen des Sokratischen Gesprächs – unter anderem Dieter Birnbacher, Klaus Blesenkemper, Klaus Draken, Dieter Krohn, Gisela Raupach-Strey und Ute Siebert –, wie die Methode im Philosophie- und Ethikunterricht angewandt werden kann. Wie alle Bücher dieser Reihe endet auch dieser Band mit einer Auswahlbibliographie.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | U1 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Einführung | 7 | ||
| Martina Peters & Jörg Peters: „Nicht-Lehren“, „Dialektik“, „Elenktik“ und „Mäeutik“ – Elemente des sokratischen Dialogs im Neosokratischen Gespräch | 7 | ||
| „Ich aber bin niemals jemandes Lehrer gewesen“ | 7 | ||
| Die Elemente des Neosokratischen Gesprächs | 12 | ||
| Das Sokratische Gespräch in der Schule | 14 | ||
| 1 Theorie des Sokratischen Gesprächs im Philosophie- und Ethikunterricht | 15 | ||
| Leonard Nelson: Die sokratische Methode | 15 | ||
| Gustav Heckmann: Sechs pädagogische Maßnahmen | 45 | ||
| Ute Siebert: Der Ursprung der sokratischen Methode in der griechischen Antike | 51 | ||
| Wahrheitssuche in den platonischen Dialogen | 51 | ||
| Die Maieutik des Sokrates | 52 | ||
| Rainer Loska: Vergleich der sokratischen Methode bei Sokrates und Nelson | 57 | ||
| Die Frage im sokratischen Gespräch | 57 | ||
| Exkurs | 60 | ||
| Ein anderes dialogisches Modell: der Partner als Anreger bei Kleist | 60 | ||
| Die Erweiterung des Dialogs – eine Stelle bei Platon | 62 | ||
| Gesprächssteuernde Fragen bei Nelson | 66 | ||
| Das Problem des gegenseitigen Verstehens im Gespräch | 68 | ||
| Die Rolle der Zustimmung für den Gesprächsverlauf | 70 | ||
| Detlef Horster: Theoretische Grundlagen des Sokratischen Gesprächs heute | 75 | ||
| Vernunftauffassung und Erfahrungsprozess im Sokratischen Gespräch | 79 | ||
| 2 Praxis des Sokratischen Gesprächs im Philosophie- und Ethikunterricht | 87 | ||
| Dieter Birnbacher: Das Sokratische Gespräch – eine philosophische Standortbestimmung | 87 | ||
| Von der Sokratischen Methode zum Sokratischen Gespräch | 87 | ||
| Die sokratische Methode | 87 | ||
| Das Sokratische Gespräch bei Nelson und Heckmann | 90 | ||
| Vom Sokratischen Gespräch zum „sokratischen Paradigma“ der Philosophie | 91 | ||
| Eigene Erfahrungen mit Sokratischen Gesprächen | 97 | ||
| Gustav Heckmann & Dieter Krohn: Über Sokratisches Gespräch und Sokratische Arbeitswochen | 101 | ||
| Zur heutigen Situation des Sokratischen Gesprächs | 101 | ||
| Zu den Grundlagen des Sokratischen Gesprächs | 101 | ||
| Zur Praxis des Sokratischen Gesprächs | 107 | ||
| Gisela Raupach-Strey: Grundregeln des Sokratischen Gesprächs | 109 | ||
| Wolfgang Klafki: Vernunft – Erziehung – Demokratie | 123 | ||
| Klaus Blesenkemper: Das sokratische Gespräch | 131 | ||
| Vom Dialog des platonischen Sokrates zum (neo-)sokratischen Gespräch | 131 | ||
| 1. Der platonische Sokrates als – teils fragwürdiges – Vorbild | 131 | ||
| 2. Kant als moderner Sokratiker? – ! | 133 | ||
| 3. Nelson als Begründer der neosokratischen Methode | 135 | ||
| 4. Heckmann als Entwickler des neosokratischen Gesprächs | 137 | ||
| Das neosokratische Gespräch in der Schule | 139 | ||
| 1. Themenbereiche und Fragestellungen | 139 | ||
| 2. Regeln und Tugenden für Teilnehmerinnen und Teilnehmer | 140 | ||
| 3. Regeln und Tipps für die Gesprächsleitung | 141 | ||
| 4. Phasen des sokratischen Gesprächs | 142 | ||
| 5. Das sokratische Gespräch in unterschiedlichen unterrichtlichen Konstellationen | 144 | ||
| Klaus Draken: Sokratisches Gespräch und Lehrgespräch | 147 | ||
| Vorbemerkung: ein Widerspruch | 147 | ||
| Das Lehrgespräch als fragend-entwickelndes Unterrichtsgespräch | 148 | ||
| Prinzipielle Probleme des Verfahrens | 148 | ||
| Sinnvoll erscheinende Anlässe | 149 | ||
| Einige Regeln | 150 | ||
| Fragetechnik | 153 | ||
| Beispieldialog 1 | 153 | ||
| Beispieldialog 2 | 154 | ||
| Grenzen des Verfahrens | 155 | ||
| Das Sokratische Gespräch als Schule des Selbstdenkens | 155 | ||
| Regeln für Teilnehmende und Gesprächsleitung | 155 | ||
| Zum Ablauf eines Sokratischen Gesprächs | 157 | ||
| Fragetechnik | 159 | ||
| Grenzen des Sokratischen Gesprächs | 160 | ||
| Konsequenzen für die unterrichtliche Praxis | 161 | ||
| Gisela Raupach-Strey: Die Bedeutung der Sokratischen Methode für den Philosophie- und Ethikunterricht | 165 | ||
| Inwiefern die Sokratische Methode den Zielen des Philosophie- bzw. Ethik-Unterrichts entspricht | 165 | ||
| Konstitutive Elemente der Sokratischen Methode in ihrer Relevanz für den Philosophie- bzw. Ethik-Unterricht | 168 | ||
| 1. Die Voraussetzungslosigkeit | 168 | ||
| 2. Die Erfahrungsbasis | 168 | ||
| 3. Der Non-Dogmatismus | 169 | ||
| 4. Maieutik | 169 | ||
| 5. Das Selbstvertrauen der Vernunft | 170 | ||
| 6. Die Denkgemeinschaft | 170 | ||
| 7. Wahrheit und Verbindlichkeit | 171 | ||
| Vorzüge des Sokratischen Ansatzes im dissonanten Konzert der Konzeptionen für den „Philosophie- bzw. Ethik-Unterricht“: | 171 | ||
| Klaus Draken: Schulunterricht und das Sokratische Gespräch nach Leonard Nelson und Gustav Heckmann | 177 | ||
| Was sind die besonderen Qualitäten des Sokratischen Gesprächs, die den Wunsch nach seiner Anwendung in der Schule hervorrufen? | 177 | ||
| Was sind die Probleme, die die Möglichkeit einer Verwirklichung dieses Wunsches zweifelhaft erscheinen lassen? | 179 | ||
| Was lässt sich für die mögliche Zukunft im Verhältnis von Schulunterricht und Sokratischem Gespräch folgern? | 181 | ||
| Barbara Neißer: Das sokratische Gespräch im Philosophieunterricht der Sekundarstufe II | 183 | ||
| Vorbemerkung | 183 | ||
| Warum soll das sokratische Gespräch in den Philosophieunterricht integriert werden? | 183 | ||
| Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit ein sokratischer Philosophieunterricht gelingen kann? | 185 | ||
| Erfahrungen mit dem sokratischen Gespräch im Philosophieunterricht | 187 | ||
| 1. Beispiel | 187 | ||
| 2. Beispiel | 189 | ||
| Konsequenzen aus meinen praktischen Erfahrungen | 191 | ||
| Gisela Raupach-Strey: Das positive Potential des Sokratischen Paradigmas am Lernort Schule | 193 | ||
| Zu Modell 1: | 193 | ||
| Zu Modell 2: | 195 | ||
| Zu Modell 3: | 196 | ||
| Zu Modell 4: | 199 | ||
| Dialogische Deutung der Unterrichtssituation | 200 | ||
| Klaus Blesenkemper: Neosokratisches Denkerlebnis – „Schadenfreude“ | 205 | ||
| Zur Theorie einer erwünschten Praxis | 205 | ||
| Den Schulalltag „neosokratisch infizieren“ | 206 | ||
| Protokoll eines ›neosokratischen Infektionsversuchs‹ | 207 | ||
| Vorbereitung und Rahmenbedingungen | 207 | ||
| Zur Methode | 207 | ||
| Zur Sache | 207 | ||
| Zur Einführung | 208 | ||
| Verlauf und Ergebnisse | 209 | ||
| Lindas Beispiel ›Laterne‹ | 209 | ||
| Fazit | 211 | ||
| Klaus Draken: Eignet sich das „Sokratische Gespräch“ für die Schule? | 213 | ||
| Eigene Unterrichtsversuche mit dem Sokratischen Gespräch | 213 | ||
| Erstes Sokratisches Schulgespräch: Warum haben wir (keine) Angst vor dem Tod? | 216 | ||
| Zweites Sokratisches Schulgespräch: Was bedeuten Tod und Sterben für mein Leben? | 218 | ||
| Drittes Sokratisches Schulgespräch: Worin liegt der Sinn des Todes für unser Leben? | 220 | ||
| Grundlagen einer Bewertung | 221 | ||
| Auswahlbibliographie | 227 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish