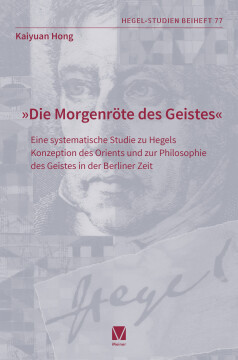
BUCH
„Die Morgenröte des Geistes“
Eine systematische Studie zu Hegels Konzeption des Orients und zur Philosophie des Geistes in der Berliner Zeit
Hegel-Studien, Beihefte, Bd. 77
2025
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Kein anderer Denker der klassischen deutschen Philosophie hat sich so wie Hegel mit dem Orient beschäftigt. Hegels Konzeption des Orients ist aber nicht leicht zu erfassen und darzustellen. Denn die Rekonstruktion wirft eine ganze Reihe schwieriger methodischer und sachlicher Probleme auf. Neben der nicht unproblematischen Textgrundlage, den Nachschriften zu seinen Berliner Vorlesungen, betrifft dies vor allem den systematischen Stellenwert des Orients in der »Geschichte des Geistes«. Berühmt ist Hegels These, dass es im Orient noch keine Freiheit gab und sich der Geist zum Wissen seiner selbst im weltgeschichtlichen Gang von Ost nach West entwickelt hat. Hegel hat diese historische Entwicklung jedoch so gut wie nie eigens thematisiert. Dieses Desiderat erkannt zu haben und Hegels implizite Annahmen in ihrer Komplexität zu diskutieren, ist die Leistung dieser umfassenden wie auch subtilen Studie. Am Schluss ordnet der Autor den Ertrag seiner Analyse in die aktuelle Eurozentrismus-Diskussion ein.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | U1 | ||
| Titelblatt | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Zitierweise, Siglen und Abkürzungen | 11 | ||
| Werkausgaben | 12 | ||
| Abkürzungen | 13 | ||
| I. Einleitung | 15 | ||
| 1. Zwischen System und Materialien: Die Herangehensweise an Hegels Konzeption des Orients | 15 | ||
| 2. Die systematische Grundlage der Untersuchung | 20 | ||
| 3. Die Textgrundlage zu Hegels Werken | 24 | ||
| 4. Überblick und Einteilung | 31 | ||
| II. Die systematische Grundlage: Die Weiterentwicklung der Philosophie des Geistes | 37 | ||
| 1. Hegels Theorie des weltgeschichtlichen Volks | 39 | ||
| 1.1 Die ''unzertrennliche Einheit'' des Volks | 39 | ||
| 1.2 Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Seiten der Einheit des Volks | 41 | ||
| 1.2.1 Die grundlegende Struktur des Modells der dynamischen Entfaltung | 44 | ||
| 1.2.2 Die Entfaltung der grundlegenden Struktur | 51 | ||
| 1.2.3 Zusammenfassung | 60 | ||
| 2. Die Rekonstruktion der Geschichte des Geistes | 67 | ||
| 2.1 Die fehlende Geschichte des Geistes | 67 | ||
| 2.1.1 Das erste Modell der ''absoluten Geschichte'' | 69 | ||
| 2.1.2 Das zweite Modell der ''absoluten Geschichte'' | 74 | ||
| 2.1.3 Die Geschichte des Geistes statt der ''absoluten Geschichte'' | 79 | ||
| 2.2 Die Strukturierung der Geschichte des Geistes | 89 | ||
| 2.2.1 Der vierstufige Fortgang vom Bewusstsein zum Selbstbewusstsein | 91 | ||
| 2.2.2 Der Begriff der Religion statt der logischen Grundlegung | 93 | ||
| 2.2.3 Die Parallelität zwischen der Dreiteilung der Logik und der Religionsgeschichte | 98 | ||
| 2.2.4 Das erste Strukturierungsprinzip und Hegels ''Widerlegung des Spinozismus'' | 101 | ||
| 2.2.5 Das zweite Strukturierungsprinzip und ihre Spannung mit dem ersten | 114 | ||
| 3. Zusammenfassung und Einleitung zur Rekonstruktion der Konzeption des Orients | 118 | ||
| III. Die Rekonstruktion von Hegels Konzeption des Orients | 123 | ||
| 1. Die erste Konzeption des Orients oder ihr Prototyp (1819–1821) | 125 | ||
| 1.1 Der Orient | 125 | ||
| 1.1.1 Hegels Quellenlage | 125 | ||
| 1) Das philosophiegeschichtliche Kolleg 1819 | 128 | ||
| 2) Das kunstphilosophische Kolleg 1820/21 | 132 | ||
| 3) Das philosophiegeschichtliche Kolleg 1820/21 | 134 | ||
| 4) Das religionsphilosophische Kolleg 1821 | 135 | ||
| 1.1.2 Das orientalische Prinzip | 136 | ||
| 1) Das Verhältnis des Unendlichen zum Endlichen | 136 | ||
| 2) Das Verhältnis des Menschen zum Unendlichen | 141 | ||
| 1.2 Die jüdische Welt | 144 | ||
| 1.2.1 Hegels Quellenlage | 144 | ||
| 1.2.2 Das jüdische Prinzip | 144 | ||
| 1) Das Verhältnis des Unendlichen zum Endlichen | 145 | ||
| 2) Das Verhältnis des Menschen zum Unendlichen | 149 | ||
| 1.3 Zusammenfassung der ersten Konzeption des Orients und ihre Problematik | 151 | ||
| 2. Die zweite Konzeption des Orients oder ihr Ausreifen (1822/23–1827) | 154 | ||
| 2.1 China und die buddhistische Welt | 159 | ||
| 2.1.1 Hegels Quellenlage | 159 | ||
| 1) Das geschichtsphilosophische Kolleg 1822/23 | 159 | ||
| 2) Das philosophiegeschichtliche Kolleg 1823/24 | 161 | ||
| 3) Das religionsphilosophische Kolleg 1824 | 162 | ||
| 4) Das geschichtsphilosophische Kolleg 1824/25 | 162 | ||
| 5) Das philosophiegeschichtliche Kolleg 1825/26 | 163 | ||
| 6) Das geschichtsphilosophische Kolleg 1826/27 | 163 | ||
| 7) Das religionsphilosophische Kolleg 1827 | 164 | ||
| 2.1.2 Das chinesische Prinzip | 164 | ||
| 1) Das Verhältnis des Unendlichen zum Endlichen | 164 | ||
| 2) Das Verhältnis des Menschen zum Unendlichen | 172 | ||
| 2.1.3 Die Ausprägung des chinesischen Prinzips | 174 | ||
| 1) Kunst | 174 | ||
| 2) Staat | 175 | ||
| 3) Philosophie | 177 | ||
| 2.1.4 Der Übergang | 177 | ||
| Das daoistische Prinzip | 178 | ||
| Das buddhistische Prinzip | 179 | ||
| 1) Das Verhältnis des Unendlichen zum Endlichen | 179 | ||
| 2) Das Verhältnis des Menschen zum Unendlichen | 182 | ||
| 3) Die Gemeinde | 185 | ||
| 2.1.5 Zusammenfassung | 186 | ||
| 2.2 Indien | 188 | ||
| 2.2.1 Hegels Quellenlage | 189 | ||
| 1) Das geschichtsphilosophische Kolleg 1822/23 | 189 | ||
| 2) Das kunstphilosophische Kolleg 1823 | 190 | ||
| 3) Das philosophiegeschichtliche Kolleg 1823/24 | 190 | ||
| 4) Das religionsphilosophische Kolleg 1824 | 190 | ||
| 5) Das geschichtsphilosophische Kolleg 1824/25 | 191 | ||
| 6) Das philosophiegeschichtliche Kolleg 1825/26 | 191 | ||
| 7) Das kunstphilosophische Kolleg 1826 | 191 | ||
| 8) Das geschichtsphilosophische Kolleg 1826/27 | 191 | ||
| 9) Humboldt-Rezension | 191 | ||
| 10) Das religionsphilosophische Kolleg 1827 | 193 | ||
| 2.2.2 Das indische Prinzip | 193 | ||
| 1) Das Verhältnis des Unendlichen zum Endlichen | 193 | ||
| 2) Das Verhältnis des Menschen zum Unendlichen im ersten Extrem | 195 | ||
| 3) Das Verhältnis des Menschen zum Unendlichen im zweiten Extrem | 197 | ||
| 2.2.3 Die Ausprägung des indischen Prinzips | 201 | ||
| 1) Kunst | 202 | ||
| 2) Staat | 205 | ||
| 3) Philosophie | 207 | ||
| 2.2.4 Zusammenfassung | 209 | ||
| 2.3 Persien | 211 | ||
| 2.3.1 Hegels Quellenlage | 211 | ||
| 1) Das geschichtsphilosophische Kolleg 1822/23 | 211 | ||
| 2) Das kunstphilosophische Kolleg 1823 | 211 | ||
| 3) Das philosophiegeschichtliche Kolleg 1823/24 | 211 | ||
| 4) Das religionsphilosophische Kolleg 1824 | 211 | ||
| 5) Das geschichtsphilosophische Kolleg 1824/25 | 212 | ||
| 6) Das kunstphilosophische Kolleg 1826 | 212 | ||
| 7) Das geschichtsphilosophische Kolleg 1826/27 | 212 | ||
| 8) Das religionsphilosophische Kolleg 1827 | 212 | ||
| 2.3.2 Das persische Prinzip | 212 | ||
| 1) Das Verhältnis des Unendlichen zum Endlichen | 213 | ||
| 2) Das Verhältnis des Menschen zum Unendlichen | 215 | ||
| 2.3.3 Die Ausprägung des persischen Prinzips | 219 | ||
| 1) Kunst | 219 | ||
| 2) Staat | 219 | ||
| 3) Philosophie | 222 | ||
| 2.3.4 Der Übergang | 222 | ||
| Das phönizische Prinzip | 222 | ||
| Das syrische Prinzip | 223 | ||
| 2.3.5 Zusammenfassung | 224 | ||
| 2.4 Ägypten | 225 | ||
| 2.4.1 Hegels Quellenlage | 226 | ||
| 1) Das geschichtsphilosophische Kolleg 1822/23 | 226 | ||
| 2) Das kunstphilosophische Kolleg 1823 | 226 | ||
| 3) Das religionsphilosophische Kolleg 1824 | 226 | ||
| 4) Das geschichtsphilosophische Kolleg 1824/25 | 226 | ||
| 5) Das kunstphilosophische Kolleg 1826 | 227 | ||
| 6) Das geschichtsphilosophische Kolleg 1826/27 | 227 | ||
| 7) Das religionsphilosophische Kolleg 1827 | 227 | ||
| 2.4.2 Das ägyptische Prinzip | 228 | ||
| 1) Das Verhältnis des Unendlichen zum Endlichen | 228 | ||
| 2) Das Verhältnis des Menschen zum Unendlichen | 234 | ||
| 2.4.3 Die Ausprägung des ägyptischen Prinzips | 237 | ||
| 1) Kunst | 238 | ||
| 2) Staat | 240 | ||
| 3) Philosophie | 241 | ||
| 2.4.4 Zusammenfassung | 242 | ||
| 2.5 Die jüdische Welt | 243 | ||
| 2.5.1 Hegels Quellenlage | 244 | ||
| 1) Das geschichtsphilosophische Kolleg 1822/23 | 244 | ||
| 2) Das kunstphilosophische Kolleg 1823 | 244 | ||
| 3) Das religionsphilosophische Kolleg 1824 | 244 | ||
| 4) Das geschichtsphilosophische Kolleg 1824/25 | 244 | ||
| 5) Das philosophiegeschichtliche Kolleg 1825/26 | 244 | ||
| 6) Das kunstphilosophische Kolleg 1826 | 244 | ||
| 7) Das geschichtsphilosophische Kolleg 1826/27 | 244 | ||
| 8) Das religionsphilosophische Kolleg 1827 | 245 | ||
| 2.5.2 Das jüdische Prinzip | 245 | ||
| 1) Das Verhältnis des Unendlichen zum Endlichen | 245 | ||
| 2) Das Verhältnis des Menschen zum Unendlichen | 247 | ||
| 2.5.3 Die Ausprägung des jüdischen Prinzips | 250 | ||
| 1) Kunst | 250 | ||
| 2) Staat | 251 | ||
| 3) Philosophie | 253 | ||
| 2.5.4 Zusammenfassung | 254 | ||
| 2.6 Zusammenfassung der zweiten Konzeption des Orients und ihre Problematik | 255 | ||
| 3. Die dritte Konzeption des Orients oder ihr Zwiespalt (1828/29–1831) | 262 | ||
| 3.1 China | 266 | ||
| 3.1.1 Hegels Quellenlage | 266 | ||
| 1) Kolleg 1828/29 | 266 | ||
| 2) Kolleg 1830/31 | 266 | ||
| 3) Kolleg 1831 | 267 | ||
| 3.1.2 Das chinesische Prinzip oder die erste Form des Pantheismus | 267 | ||
| 1) Das Verhältnis des Unendlichen zum Endlichen | 267 | ||
| 2) Das Verhältnis des Menschen zum Unendlichen | 270 | ||
| 3.1.3 Die Ausprägung des chinesischen Prinzips | 271 | ||
| Kunst | 271 | ||
| Staat | 271 | ||
| 3.2 Indien | 271 | ||
| 3.2.1 Hegels Quellenlage | 272 | ||
| 1) Das kunstphilosophische Kolleg 1828/29 | 272 | ||
| 2) Das geschichtsphilosophische Kolleg 1830/31 | 272 | ||
| 3) Das religionsphilosophische Kolleg 1831 | 272 | ||
| 3.2.2 Das indische Prinzip oder die zweite Form des Pantheismus | 272 | ||
| 1) Das Verhältnis des Unendlichen zum Endlichen | 273 | ||
| 2) Das Verhältnis des Menschen zum Unendlichen im ersten Extrem | 274 | ||
| 3) Das Verhältnis des Menschen zum Unendlichen im zweiten Extrem | 275 | ||
| 3.2.3 Die Ausprägung des indischen Prinzips | 277 | ||
| Kunst | 277 | ||
| Staat | 277 | ||
| 3.3 Die buddhistische Welt | 278 | ||
| 3.3.1 Hegels Quellenlage | 278 | ||
| 1) Kolleg 1830/31 | 278 | ||
| 2) Kolleg 1831 | 278 | ||
| 3.3.2 Das buddhistische Prinzip oder die dritte Form des Pantheismus | 279 | ||
| 1) Das Verhältnis des Unendlichen zum Endlichen | 279 | ||
| 2) Das Verhältnis des Menschen zum Unendlichen | 280 | ||
| 3) Die Gemeinde | 281 | ||
| 3.4 Persien | 281 | ||
| 3.4.1 Hegels Quellenlage | 282 | ||
| 1) Kolleg 1828/29 | 282 | ||
| 2) Kolleg 1830/31 | 282 | ||
| 3) Kolleg 1831 | 282 | ||
| 3.4.2 Das persische Prinzip | 282 | ||
| 1) Das Verhältnis des Unendlichen zum Endlichen | 282 | ||
| 2) Das Verhältnis des Menschen zum Unendlichen | 284 | ||
| 3.4.3 Die Ausprägung des persischen Prinzips | 285 | ||
| Kunst | 285 | ||
| Staat | 285 | ||
| 3.5 Die jüdische Welt | 285 | ||
| 3.5.1 Hegels Quellenlage | 286 | ||
| 1) Kolleg 1828/29 | 286 | ||
| 2) Kolleg 1830/31 | 286 | ||
| 3) Kolleg 1831 | 286 | ||
| 3.5.2 Das jüdische Prinzip | 286 | ||
| 1) Das Verhältnis des Unendlichen zum Endlichen | 287 | ||
| 2) Das Verhältnis des Menschen zum Unendlichen | 289 | ||
| 3.5.3 Die Ausprägung des jüdischen Prinzips | 291 | ||
| Kunst | 291 | ||
| Staat | 292 | ||
| 3.6 Vorderasien | 292 | ||
| 3.6.1 Hegels Quellenlage | 292 | ||
| 3.6.2 Das vorderasiatische Prinzip | 292 | ||
| 3.7 Ägypten | 295 | ||
| 3.7.1 Hegels Quellenlage | 296 | ||
| 1) Kolleg 1828/29 | 296 | ||
| 2) Kolleg 1830/31 | 296 | ||
| 3) Kolleg 1831 | 296 | ||
| 3.7.2 Das ägyptische Prinzip | 296 | ||
| 3.7.3 Die Ausprägung des ägyptischen Prinzips | 299 | ||
| Kunst | 300 | ||
| Staat | 300 | ||
| 3.8 Zusammenfassung der dritten Konzeption des Orients und ihre Problematik | 300 | ||
| IV. Schluss und Ausblick | 307 | ||
| Literaturverzeichnis | 317 | ||
| 1.1 Werkausgaben | 317 | ||
| Georg Wilhelm Friedrich Hegel | 317 | ||
| Wilhelm von Humboldt | 317 | ||
| Friedrich Heinrich Jacobi | 317 | ||
| 1.2 Einzelausgaben | 317 | ||
| 2. Hegels Quellen | 318 | ||
| China | 318 | ||
| Die buddhistische Welt | 320 | ||
| Indien | 322 | ||
| Persien | 327 | ||
| Ägypten | 328 | ||
| Die jüdische Welt | 329 | ||
| 3. Sekundärliteratur | 330 | ||
| 1. Primärtexte | 317 | ||
| Danksagung | 359 | ||
| Anhang: Tabellen | *1 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish