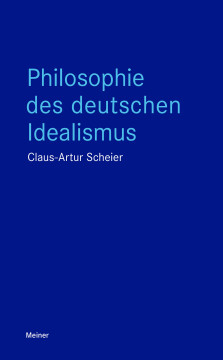
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Dieser Band enthält 26 Aufsätze und Vorträge zu den wichtigsten Denkern der klassischen deutschen Philosophie. Beginnend mit einem Text zur Unendlichkeit von Cusanus bis Hegel versammelt er u. a. Beiträge zu Rousseau, Kant, Fichte, Schiller, Schelling, Solger und Hegel und behandelt damit das gesamte philosophische Spektrum der Epoche. Der deutsche Idealismus bleibt aktuell, so Scheier, weil das moderne Denken sich geschichtlich immer neu zu legitimieren genötigt ist. Denn es bezieht seine Legitimation aus der Abgrenzung vom scheinbaren Fortbestehen vergangener metaphysischer Optionen. Als wie triftig aber erweisen sich Nietzsches, Heideggers oder Derridas Konzepte dieser Geschichte, die jeweils als Dekadenzprozess, zunehmende Seinsvergessenheit oder Abschließung im Sich-sprechen-hören-Wollen gefasst wurden? Seit der frühen Neuzeit (und grundgelegt schon im Denken der frühen griechischen Poleis) ist die europäische Philosophie eine progressive Theorie der Freiheit, derer wir uns wohl vergewissern müssen, um in der globalen Krise der Demokratie Rede zu stehen, wer wir sind und was wir nicht bereit sein können, uns nehmen zu lassen.Claus-Artur Scheier ist emeritierter Professor für Philosophie an der TU Braunschweig mit den Schwerpunkten Klassische Philosophie, Deutscher Idealismus und antimetaphysisches Denken im 19. und 20. Jhd. Scheier ist u.a. Herausgeber von Friedrich Nietzsches »Philosophischen Werken in sechs Bänden« (PhB 651-656). In der Blauen Reihe erschien 2016: Luhmanns Schatten. Zur Funktion der Philosophie in der medialen Moderne.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | U1 | ||
| Titelblatt | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Vorwort | 7 | ||
| Unendlichkeit: Von Cusanus zu Hegel | 9 | ||
| I. Das Jahrhundert Rousseaus | 21 | ||
| Vernunft und Gegenvernunft? nAufklärung, Romantik und Globalisierung | 23 | ||
| Zum logischen Grund des nneuzeitlichen Humanismus | 30 | ||
| Rousseaus Supplement und das ndramatische Prinzip der Aufklärung | 37 | ||
| Synthesis a priori – nZur ersten Philosophie zwischen 1781 und 1817 | 49 | ||
| Die Zeit der Spontaneitätn – Zu Kants Lehre von der transzendentalen Funktion nder Einbildungskraft. nMit einer Fußnote zu Descartes’ Regeln der Methode | 64 | ||
| II. Idealismus und Frühromantik | 87 | ||
| Die Struktur der Reflexion im § 1 von nFichtes Grundlage (1794) | 89 | ||
| Das älteste Systemprogramm des ndeutschen Idealismus und Hegels Differenzschrift | 110 | ||
| Die Frühromantik als Kultur der Reflexion | 118 | ||
| Die Bedeutung der Naturphilosophie nim deutschen Idealismus | 133 | ||
| Entzweiung als Bildung des Zeitalters – nHegel und Rousseau im kulturphilosophischen Kontext | 145 | ||
| III. Peripetien der Kunst | 161 | ||
| Schiller – Architekt der transzendentalen Tragödie | 163 | ||
| Kants dritte Antinomie und die nGenese des tragischen Gedankens: nSchelling 1795–1809 | 194 | ||
| Schellings Angst und der Klassizismus | 211 | ||
| Offenbarung im Untergang – Zum geschichtlichen Ort der Ästhetik K. W. F. Solgers | 224 | ||
| Der Begriff der Farbe und die Farbe des Begriffs in Hegels Ästhetik | 241 | ||
| IV. Natur und Geschichte | 249 | ||
| Natur – vor und nach der industriellen Revolution (mit einem Blick auf Hegel) | 251 | ||
| Das wissende Werden – zur Geschichte nin Hegels Phänomenologie des Geistes | 257 | ||
| Die Sprache und das Wort nin Hegels Phänomenologie des Geistes | 268 | ||
| Gestalten des Todes in Hegels Phänomenologie des Geistes | 278 | ||
| Die Negation im Dasein. Zum systematischen Ort eines methodischen Terminus in Hegels Wissenschaft der Logik | 287 | ||
| V. Idealismus und Moderne | 305 | ||
| Die Zeit der Seynsfuge – Zu Heideggers Interesse an Schellings Freiheitsschrift | 307 | ||
| Schelling – Denker der Differenz | 320 | ||
| Schellings Modernität: Abgrund und Grenze | 334 | ||
| Hegels Nihilismus – Zur Matrix der Moderne | 348 | ||
| Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit – Hegel und die Zukunft | 359 | ||
| Anmerkungen | 373 | ||
| Siglen und Abkürzungen | 410 | ||
| Literatur | 413 | ||
| Namenregister | 437 | ||
| Nachweise | 443 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish