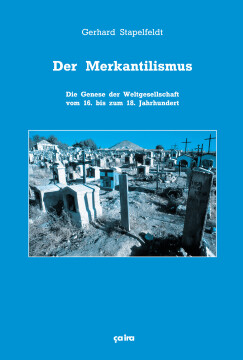
BUCH
Der Merkantilismus
Die Genese zur Weltgesellschaft vom 16. bis zum 17. Jahrhundert
2001
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Der Text ist der erste einer Reihe über die Epochen der bürgerlichen Ökonomie. Es werden Darstellungen des Liberalismus und des Imperialismus folgen. In diesen Texten geht es um eine historisch-genetische Darstellung des Systems der bürgerlichen Ökonomie, des »historischen Kapitalismus« (Wallerstein). Das erste Kapitel liefert eine Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Merkantilismus von den Anfängen bis zum Übergang in den Liberalismus. Das zweite Kapitel behandelt die englische Politik-Ökonomie und Gesellschaftsphilosophie des Merkantilismus. Es werden die Hauptwerke von Thomas Hobbes, William Petty, John Locke, John Law, Bernard Mandeville und David Hume kritisch erörtert. Am Schluß stehen die utopischen Kritiken von Thomas More und Francis Bacon. Das dritte Kapitel behandelt die Französische Politische Ökonomie von Pierre Le Pesant de Boisguilbert bis zu François Quesnay und Anne Robert Jacques Turgot. Am Schluß steht hier die zeitgenössische utopische Kritik der europäischen Welteroberung von Michel de Montaigne. Zum Abschluß werden die realen und theoretischen Tendenzen herausgestellt, die den Übergang vom Merkantilismus in die nachfolgende Phase des Liberalismus anzeigen.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | U1 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Vorwort | 9 | ||
| Erstes Kapitel: Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Merkantilismus | 26 | ||
| 1. Die Prinzipien des Merkantilismus – Die Rolle der Gewalt bei der Durchsetzung des Kapitalismus | 36 | ||
| 2. Handelskapital und Entwicklung der Produktion: Die führende Rolle der Niederlande im 16. Jahrhundert | 51 | ||
| 3. Genesis des merkantilistischen Kapitalismus in England | 64 | ||
| 3.1 Revolutionierung des Agrarsektors, Handel und ländlich-städtische Manufakturproduktion in England | 64 | ||
| 3.2 Englands Aufstieg zur führenden Handelsnation | 83 | ||
| 4. Portugal und Spanien: Aufstieg zur Weltherrschaft und Unterentwicklung in der bürgerlichen Welt | 102 | ||
| 5. Die Rolle Frankreichs in der merkantilistischen Weltwirtschaft | 120 | ||
| 6. Das Gewaltsystem der Produktion in Lateinamerika | 128 | ||
| 7. Das System der Weltwirtschaft: Die Integration Afrikas in die merkantilistische Weltwirtschaft | 148 | ||
| 8. Das Ende des Merkantilismus im 18. Jahrhundert | 159 | ||
| Zweites Kapitel: Die englische Politik-Ökonomie des Merkantilismus | 167 | ||
| 1. Die Dogmen des Merkantilismus | 169 | ||
| 1.1 Philipp Wilhelm von Hornigk und Johann Heinrich Gottlob von Justi: Die kameralistische Lehre vom Geld als Schatz (1684/1755) | 170 | ||
| 1.2 Thomas Mun: Verwandlung von Geld in Handelskapital (1625/30) | 187 | ||
| 2. Thomas Hobbes’ ›Leviathan‹ (1651): Die Rolle der Gewalt bei der Konstitution der bürgerlichen Gesellschaft | 196 | ||
| 2.1 Der Naturzustand. Hobbes’ anthropologische Begründung eines »bellum omium contra omnes« | 200 | ||
| 2.2 Der Übergang vom Naturrecht zum Naturgesetz und zum Common Wealth durch Vertrag | 215 | ||
| 2.3 Die staatliche Gesellschaft und politische Ökonomie des ›Leviathan‹ | 226 | ||
| 3. William Petty: Politische Ökonomie (1662–1689) | 256 | ||
| 3.1 W.Petty’s Merkantilismus | 257 | ||
| 3.2 Staat und Ökonomie | 261 | ||
| 3.3 Wert-Theorie: Zwischen mythologischer und liberaler Ökonomie | 265 | ||
| 4. John Locke: Merkantilismus im liberalen Naturrecht (1690) | 280 | ||
| 4.1 Der Doppelcharakter von Eigentum, Freiheit und Gleichheit | 290 | ||
| 4.2 Gewalt als Gegensatz zur »Gemeinschaft der Natur« | 298 | ||
| 4.3 Privateigentum, Geld, Handel: Zwei Phasen des Naturzustandes | 302 | ||
| 5. John Law of Lauriston: Theorie des Papiergeldes. Vom Silber zum Boden als Wertmaß (1705) | 325 | ||
| 6. Bernard Mandeville: ›Private Laster, öffentliche Vorteile‹ (1705-1732) | 334 | ||
| 6.1 Die These der ›Bienenfabel‹, erläutert am Gedicht | 335 | ||
| 6.2 Der anthropologisch-triebtheoretische Ansatz der Gesellschaftstheorie: Der Mensch im Naturzustand | 341 | ||
| 6.3 Der Übergang in die »politische Gesellschaft«: Der aus Selbstliebe tugendhafte Mensch | 349 | ||
| 6.4 Der Tugend-Staat: Mandeville’s Kritik des calvinistischen Merkantilismus der Niederlande | 359 | ||
| 6.5 Der Leviathan als Handelsstaat: »Private Laster, öffentliche Vorteile« | 365 | ||
| 7. David Hume: Übergang vom Handels- zum industriellen Kapital (1752) | 383 | ||
| 7.1 Entstehung des Handelskapitals und des Manufakturkapitals | 384 | ||
| 7.2 Das System des Handels- und Manufaktur-Kapitalismus | 392 | ||
| 8. Thomas More und Francis Bacon: Kritik aus Utopia-Amerika (1516 und 1624) | 412 | ||
| 8.1 Thomas Morus: ›Utopia‹ (1515/16) | 414 | ||
| 8.2 Francis Bacon: ›Neu-Atlantis‹ (1624) | 438 | ||
| Drittes Kapitel: Französische Politische Ökonomie. Die Physiokraten | 451 | ||
| 1. Pierre Le Pesant de Boisguilbert: Kritik des Staatsinterventionismus und Geldfetischismus – »laisser faire la nature« (1695–1714) | 454 | ||
| 1.1 Theorie des ökonomischen Systems | 458 | ||
| 1.2 Krisentheorie | 472 | ||
| 2. François Quesnay: ›Tableau Économique‹ (1758) | 487 | ||
| 3. Anne Robert Jacques Turgot: ›Betrachtungen über die Bildung und Verteilung der Reichtümer‹ (1766) | 521 | ||
| 3.1 Genesis der Klassen | 525 | ||
| 3.2 Genesis von Geld und Kapital – Kapitalverwendungen | 532 | ||
| 4. Michel de Montaigne: Kritik aus Utopia-Amerika (1580/88) | 541 | ||
| Ausblick: Erosion des Merkantilismus – Prinzipien des Liberalismus | 546 | ||
| Literatur | 559 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish