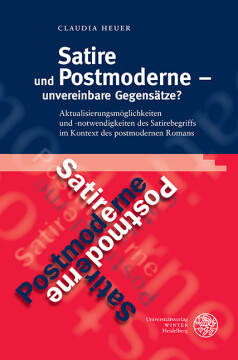
BUCH
Satire und Postmoderne – unvereinbare Gegensätze?
Aktualisierungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten des Satirebegriffs im Kontext des postmodernen Romans
Anglistische Forschungen, Bd. 439
2014
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Kann man nach der Postmoderne noch satirische Romane schreiben? Immerhin ist die traditionelle Haltung von Satiren ihrem Gegenstand gegenüber – seine eindeutige Verurteilung – vor dem Hintergrund des ontologisch-epistemologischen Zweifels der Postmoderne kaum mehr haltbar. Gleichzeitig ähneln sich postmoderne und traditionell satirische Romane hinsichtlich ihrer Gestaltungsmittel, lassen sich doch die Instrumente des satirischen ‚Arsenals‘, insbesondere ihre Ironie und ihre parodistischen Techniken, fast ausnahmslos auch als Charakteristika des postmodernen Romans auffassen. Hieraus wurde entweder gefolgert, satirisches Schreiben sei unter postmodernen Bedingungen nicht länger möglich oder die Postmoderne wurde zu einer „satirischen Ära“ erklärt. Die Arbeit kritisiert solche Ansätze und untersucht stattdessen die veränderte Funktion satirischer Mittel. So versucht sie Verallgemeinerungen zu vermeiden, die der Komplexität von zeitgenössischen satirischen Texten nicht gerecht werden.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Inhalt | 5 | ||
| 1 Einleitung | 9 | ||
| 1.1 Satire und Postmoderne – unvereinbare Gegensätze? | 9 | ||
| 1.2 Satire im zeitgenössischen Kriminalroman? | 21 | ||
| 1.3 Zum Aufbau einer satirischen Provokation | 28 | ||
| 2 Satirizing the Satirist? Zur Struktur der satirischen Kommunikation | 31 | ||
| 2.1 Die drei Pole der satirischen Kommunikation | 33 | ||
| 2.2 Satirische Aggression und moralische Autorität | 35 | ||
| 2.3 Der satirische Sprecher als unzuverlässiger Erzähler | 36 | ||
| 2.3.1 Zum Begriff des unzuverlässigen Erzählens | 37 | ||
| 2.3.2 Satirisch-rhetorische Unzuverlässigkeit | 40 | ||
| 2.4 Unzuverlässiges Erzählen und postmoderne Subjektivität | 42 | ||
| 2.5 Fallen für den Leser: Christopher Brookmyre | 44 | ||
| 2.6 Die Weisheit des Wurms: blinde Flecken in Irvine Welshs Filth | 57 | ||
| 2.7 The Difference Satire Makes in Will Selfs My Idea of Fun | 69 | ||
| 2.8 Mehrdimensionale Unzuverlässigkeit in Bret Easton Ellis’ American Psycho | 77 | ||
| 2.9 Der voll verantwortliche Leser – Zwischenergebnis | 91 | ||
| 3 Mittel der satirischen Reduktion | 93 | ||
| 3.1 Postmoderne Ironie als Hindernis in der Satirerezeption? | 93 | ||
| 3.1.1 Die Postmoderne als ‚ironische Ära’ | 94 | ||
| 3.1.2 Antiphrasische und ambige Ironien | 96 | ||
| 3.1.3 Ironie als Diskurshoheit | 99 | ||
| 3.1.4 Postmoderne Ironie | 101 | ||
| 3.1.5 Interaktion von Ironien | 107 | ||
| 3.2 Satirischer Humor zwischen Tendenz und Harmlosigkeit | 109 | ||
| 3.3 Das satirisch Groteske und die Umwertung der Werte | 114 | ||
| 3.4 Navigationen im unsicheren semantischen Gravitationsfeld: Diskurskontrolle durch Ironie, Humor und Groteske? | 120 | ||
| 3.4.1 Tragische Ironie und humorfreie Groteske in Filth | 120 | ||
| 3.4.2 My Idea of Fun als Grenzgang der satirischen Reduktion | 124 | ||
| 3.4.3 Im Spannungsfeld von Affirmation und Kritik: Der Schrecken von American Psycho | 138 | ||
| 3.4.4 Brookmyres fragwürdige Ironiker und andere Unzulänglichkeiten | 145 | ||
| 3.5 Semantische Unschärfen – Zwischenergebnis | 154 | ||
| 4 Intertextuelle Strategien als Lösung postmoderner Probleme? | 157 | ||
| 4.1 Zum Begriff der Intertextualität | 158 | ||
| 4.1.1 Intertextualität als Textbezug | 159 | ||
| 4.1.2 Intertextualität und Wirklichkeitszugriff | 160 | ||
| 4.1.3 Die satirische Ausgestaltung von Intertextualität als Wirklichkeitszugriff | 162 | ||
| 4.1.4 Satirische Intertextualität auf unterschiedlichen diegetischen Ebenen | 164 | ||
| 4.2 Von Aktualisierungen und Abgrenzung: intertextuelle Strategien | 166 | ||
| 4.2.1 Filth als Anti-Detektivroman | 166 | ||
| 4.2.2 My Idea of Fun als metafiktionales Experiment | 170 | ||
| 4.2.3 American Psycho im intertextuellen Netzwerk | 175 | ||
| 4.2.4 Christopher Brookmyres affirmative Nicht-Affirmation | 183 | ||
| 4.3 Intertextualität als Schlüssel zu postmodernen Satiren – Zwischenergebnis | 192 | ||
| 5 Satirische Wirklichkeiten | 193 | ||
| 5.1 Zur Struktur des satirischen Wirklichkeitsbezugs | 194 | ||
| 5.1.1 Satirischer Realitätsbezug als amimetischer Verweis | 194 | ||
| 5.1.2 Ästhetische Funktion des satirischen Realitätsbezugs | 195 | ||
| 5.1.3 Im Spannungsfeld von Realitätsbezug und Verzerrung | 197 | ||
| 5.2 Realismus in der crisis of representation | 199 | ||
| 5.2.1 Begriffsklärung crisis of representation | 200 | ||
| 5.2.2 Crisis of representation als epistemologisches und ontologisches Problem | 201 | ||
| 5.2.3 Crisis of representation als semiotisches Problem | 204 | ||
| 5.3 Kontrastmittel literarischer Realismus | 205 | ||
| 5.3.1 Hyperrealismus | 207 | ||
| 5.3.2 Magischer Realismus | 208 | ||
| 5.4 Texte aus der Krise | 209 | ||
| 5.4.1 Magisch realistische Elemente in Filth | 211 | ||
| 5.4.2 Die Wirklichkeit als Spiel in My Idea of Fun | 214 | ||
| 5.4.3 Wahn im Überfluss der Zeichen: Die Wirklichkeit von Patrick Bateman | 220 | ||
| 5.4.4 Christopher Brookmyre und das Ausloten semiotischer Möglichkeiten | 230 | ||
| 5.5 Zwischen fabulation und Rückübertragung – Zwischenergebnis | 239 | ||
| 6 Schlussbetrachtungen | 241 | ||
| Literaturverzeichnis | 245 | ||
| Quellen | 245 | ||
| Sekundärliteratur | 246 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish