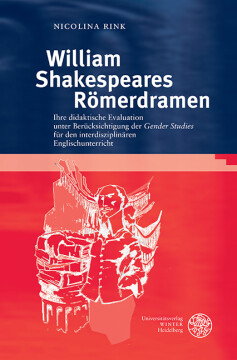
BUCH
William Shakespeares Römerdramen
Ihre didaktische Evaluation unter Berücksichtigung der ‚Gender Studies‘ für den interdisziplinären Englischunterricht
Anglistische Forschungen, Bd. 445
2014
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Das vernetzte Erlernen von Sprachen findet zunehmend Eingang in den Fremdsprachenunterricht. Dabei erweist sich die Verknüpfung der Basissprache Latein und der Kommunikationssprache Englisch als optimale Förderung der Schülerinnen und Schüler zur Erreichung sich ergänzender Kernkompetenzen wie Textverständnis, Interpretation und sprachliche Handlungsfähigkeit. Die vorliegende Untersuchung der drei Römerdramen Shakespeares, ‚Julius Caesar‘, ‚Antony & Cleopatra‘ und ‚Coriolan‘ soll Studentinnen und Studenten, Referendarinnen und Referendaren sowie Lehrerinnen und Lehrern als Handreichung dienen, neue Aspekte aus den vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten zu entwickeln. Anhand einer schüleradäquaten Textauswahl, modernen Textmethoden und Medien können Parallelen und Unterschiede zwischen Antike, Renaissance und Moderne herausgearbeitet und interdisziplinäre Zusammenhänge illustriert werden. Das Werk ist somit ein Plädoyer gegen die Marginalisierung der Literatur im Fremdsprachenunterricht und für die Vernetzung von Unterrichtsfächern.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | C | ||
| Titelei | I | ||
| Danksagungen | 3 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| 1 Grundlagen und Zielsetzungen | 13 | ||
| 1.1 Themenstellung und Primäre Ziele | 13 | ||
| 1.1.1 Multiperspektivität | 13 | ||
| 1.1.2 Interkulturelle Kompetenz | 14 | ||
| 1.1.3 Literatur im Fremdsprachenunterricht | 15 | ||
| 1.2 Untersuchungsgegenstand | 18 | ||
| 1.2.1 Mehrgliedrigkeit des Themas | 18 | ||
| 1.2.2 Textprojekt als Lehr- und Lernform | 19 | ||
| 1.2.2.1 Aktuelle Lehrmethodendiskussion | 19 | ||
| 1.2.2.2 Ursprung der Projektmethode | 21 | ||
| 1.2.2.3 Von der Projektinitiative zur Ergebnispräsentation | 24 | ||
| 1.2.2.4 Selbstgesteuerter Lernprozess | 25 | ||
| 1.2.3 Gender Studies als critical approach | 29 | ||
| 1.2.4 Shakespeares Römerdramen als Gegenstand der literaturwissenschaftlichen Analyse | 34 | ||
| 1.2.4.1 Die Zeitlosigkeit von Shakespeares Tragödien | 34 | ||
| 1.2.4.2 Definition eines Römerdramas | 37 | ||
| 1.2.4.3 Julius Caesar: Vom ersten Triumvirat bis zu den Iden des März | 40 | ||
| 1.2.4.4 Antony and Cleopatra: Zwischen Tragödie und Romanze | 42 | ||
| 1.2.4.5 Coriolan: Vom Kriegshelden zum Staatsfeind | 45 | ||
| 1.2.5 Lateinische Vergleichstexte | 47 | ||
| 1.2.5.1 Latein als multivalentes Unterrichtsfach | 47 | ||
| 1.2.5.2 Die Klassiker als Vorbild | 48 | ||
| 1.2.5.3 Literarische Geschichte der drei Römerdramen Shakespeares | 50 | ||
| 1.3 Methodik | 54 | ||
| 1.3.1 Das thematische Prinzip | 54 | ||
| 1.3.2 Vorgehensweise von der literarischen Analyse hin zu modernen Adaptionen | 56 | ||
| 1.3.3 Lehrplaneinbindung | 57 | ||
| 1.3.3.1 Kompetenzen und Bildungsstandards | 57 | ||
| 1.3.3.2 Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen | 59 | ||
| 1.3.3.3 Baden-Württemberg | 61 | ||
| 1.3.3.4 Hessen | 62 | ||
| 1.3.3.5 Nordrhein-Westfalen | 63 | ||
| 1.3.3.6 Bayern | 65 | ||
| 1.4 Forschungsstand | 68 | ||
| 1.4.1 Literaturunterricht im FSU und Projektarbeit | 68 | ||
| 1.4.2 Shakespeares Römerdramen | 68 | ||
| 1.4.3 Gender Studies | 69 | ||
| 1.4.4 Eigener Forschungsbeitrag | 70 | ||
| 2 Von den Sophisten hin zum rappenden Mark Anton | 71 | ||
| 2.1 Lebt die antike Rhetorik weiter? | 71 | ||
| 2.2 Beredsamkeit als Schlüssel zur politischen Mündigkeit in Rom | 77 | ||
| 2.2.1 Vom litterator, über den grammaticus, bis hin zum rhetor | 77 | ||
| 2.2.2 Der orator perfectus als vir bonus | 80 | ||
| 2.2.3 Schwatzhaftigkeit als weibliches Laster | 84 | ||
| 2.3 Bildung: Das Fenster zur Welt | 87 | ||
| 2.3.1 Schulbildung zur Zeit Shakespeares | 87 | ||
| 2.3.2 Paradoxe Situation der Frauen | 89 | ||
| 2.4 Julius Caesar | 91 | ||
| 2.4.1 Redestil als Ausdruck des Charakters | 91 | ||
| 2.4.1.1 Diskurs – ein Spiegel der Machtverhältnisse | 91 | ||
| 2.4.1.2 Von der Masse zum Einzelnen | 92 | ||
| 2.4.2 Prosa vs. Poesie | 94 | ||
| 2.4.3 William Shatner als rappender Mark Anton: Friends, Romans, Countrymen | 98 | ||
| 2.5 Antony and Cleopatra | 100 | ||
| 2.5.1 Neuentwurf von Antonius‘ Persönlichkeit | 100 | ||
| 2.5.2 Metaphorik der Sprache | 101 | ||
| 2.5.3 Frauenbilder in englischsprachigen Liedtexten | 103 | ||
| 2.6 Coriolan | 106 | ||
| 2.6.1 Diskrepanz zwischen Worten und Taten | 106 | ||
| 2.6.2 Verweigerung der Beredsamkeit als evolutionärer Rückschritt | 108 | ||
| 2.6.3 Männerbilder in deutschsprachigen Liedtexten | 110 | ||
| 3 Bilder als Momentaufnahmen der Seele | 113 | ||
| 3.1 Verbildlichungen als visuelle Appetitmacher | 113 | ||
| 3.2 Römische Lebensphilosophie | 115 | ||
| 3.2.1 Constantia als sinnstiftendes Konzept | 115 | ||
| 3.2.2 Streben nach Ruhm in der Nachwelt | 123 | ||
| 3.3 Great Chain of Being als Erklärungsprinzip der Welt | 126 | ||
| 3.3.1 Die Geburtsstunde der Anglikanischen Kirche | 126 | ||
| 3.3.2 Das Übernatürliche als Produkt der gestörten Sozialordnung | 127 | ||
| 3.4 Julius Caesar | 130 | ||
| 3.4.1 Fortuna als schicksalsbestimmende Kraft | 130 | ||
| 3.4.2 Brutus‘ unverbrüchliche Ideale | 133 | ||
| 3.4.3 Büsten: Versinnbildlichte constantia? | 136 | ||
| 3.5 Antonius & Cleopatra | 140 | ||
| 3.5.1 Cleopatras infinite variety | 140 | ||
| 3.5.1.1 Cleopatras unfassbares Wesen | 140 | ||
| 3.5.1.2 Überschreitung von gender boundaries | 141 | ||
| 3.5.1.3 Reinkarnation der Venus: Weiblichkeit im Übermaß | 143 | ||
| 3.5.2 Dualität von Antonius‘ Wesen: voluptas vs. virtus | 145 | ||
| 3.5.2.1 Identitätsverlust zwischen Kriegs- und Liebesdienst | 145 | ||
| 3.5.2.2 Zwischen der römischen matrona und der ägyptischen meretrix | 148 | ||
| 3.5.2.3 Im Tod Rückgewinnung der Kontrolle über das eigene Schicksal | 150 | ||
| 3.5.3 Comics als graphic novels: Asterix und Obelix bei Kleopatra | 154 | ||
| 3.6 Coriolan | 159 | ||
| 3.6.1 Das Musterbeispiel des constant Roman | 159 | ||
| 3.6.2 Soldatentum als Daseinsberechtigung | 161 | ||
| 3.6.3 Das Coriolanus-Bild in der Malerei | 163 | ||
| 4 Literarische Werke im Spiegel der Zeit | 169 | ||
| 4.1 Shakespeares Dramen im inter- und intragenerischen Vergleich | 169 | ||
| 4.2 Von der Republik hin zum Prinzipat | 176 | ||
| 4.2.1 Staatsdefinition in der römischen Literatur | 176 | ||
| 4.2.2 Zentrierung der politischen Macht auf eine Person | 180 | ||
| 4.3 Absolutistische Tendenzen der englischen Könige | 183 | ||
| 4.4 Julius Caesar | 186 | ||
| 4.4.1 Der Personenkult um Caesar | 186 | ||
| 4.4.1.1 Caesar als erster Mann im Staat | 186 | ||
| 4.4.1.2 Königin Elisabeth I. als Vorlage für die Charakterzeichnung Caesars | 191 | ||
| 4.4.1.3 Feminisierung Caesars durch die Verschwörer | 195 | ||
| 4.4.2 Brutus als überzeugter Republikaner | 197 | ||
| 4.4.3 Bertolt Brecht: Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar | 201 | ||
| 4.5 Antony and Cleopatra | 208 | ||
| 4.5.1 Konträre Regierungskonzepte von Cleopatra und Octavian | 208 | ||
| 4.5.2 Antonius zwischen den Welten | 212 | ||
| 4.5.3 G. B. Shaw: Caesar and Cleopatra | 214 | ||
| 4.6 Coriolan | 220 | ||
| 4.6.1 Streben nach völliger Autonomie | 220 | ||
| 4.6.2 Bedeutung des Volkes für den Politiker | 223 | ||
| 4.6.3 Das Volk gegen das SED-Regime: Günter Grass: Die Plebejer proben den Auf- stand | 227 | ||
| 5 Schulung der Interkulturellen Kompetenz durch film literacy | 233 | ||
| 5.1 Identitätsfindung durch Abgrenzung zum Anderen | 233 | ||
| 5.1.1 Fremdverstehen als Schlüssel zur Interkulturellen Kompetenz | 233 | ||
| 5.1.2 Othering-Strategien | 236 | ||
| 5.1.3 Schulung des Hör-Sehverstehens | 239 | ||
| 5.2 Martialisches Konzept von Männlichkeit | 243 | ||
| 5.2.1 Die Geschlechterdichotomie in Rom | 243 | ||
| 5.2.2 Familia als Spiegelbild der patria potestas | 245 | ||
| 5.2.3 Das Ideal der univira | 249 | ||
| 5.2.4 Shakespeares Römer zwischen amicitia und aemulatio | 251 | ||
| 5.3 Monumentalizing der Frauen | 254 | ||
| 5.3.1 Der Mikrokosmos in der nuclear family | 254 | ||
| 5.3.2 Frauen zwischen Inferiorität und Aufschwung | 259 | ||
| 5.3.3 Die subversive Macht des Theaters | 262 | ||
| 5.4 Julius Caesar | 266 | ||
| 5.4.1 Brutus als Cassius‘ Marionette | 266 | ||
| 5.4.2 Ein Leben zwischen domus und forum | 270 | ||
| 5.4.2.1 Calpurnia: die weitsichtige matrona | 270 | ||
| 5.4.2.2 Portia: die unkonventionelle Revoluzzerin | 274 | ||
| 5.4.2.3 Kontrastfunktion der Ehefrauen: Schaffung eines soziokulturellen Hintergrunds | 279 | ||
| 5.5 Antony and Cleopatra | 288 | ||
| 5.5.1 Römer gegen Römer: die reziproke Entwicklung von Octavian und Antonius | 288 | ||
| 5.5.2 Feminisierung Roms durch Ägypten | 292 | ||
| 5.5.3 Die Filmanalyse von Cleopatra (1963)86 als didaktisches Prinzip der Handlungs orientierung | 298 | ||
| 5.6 Coriolan | 305 | ||
| 5.6.1 Doppelgänger-Motiv als Alteritätskonzept: Aufidius als volskischer Coriolanus | 305 | ||
| 5.6.2 Abnabelung von der Mutter als emanzipatorischer Entwicklungsschritt | 306 | ||
| 5.6.2.1 Ehefrau gegen Mutter | 306 | ||
| 5.6.2.2 Komplexe Mutter-Sohn Beziehung | 309 | ||
| 5.6.3 Coriolanus (2011)60: Wirtschaftskrise im 21. Jahrhundert | 311 | ||
| 6 Zusammenfassung | 317 | ||
| 6.1 Reflexion der Ergebnisse | 317 | ||
| 6.2 Zukunft der Projektmethode: Möglichkeiten zur besseren Etablierung | 320 | ||
| 7 Literaturverzeichnis | 323 | ||
| 7.1 Primärliteratur | 323 | ||
| 7.1.1 Englische Primärliteratur | 323 | ||
| 7.1.2 Klassische Primärliteratur | 324 | ||
| 7.1.3 Sonstige Primärliteratur | 327 | ||
| 7.2 Sekundärliteratur | 328 | ||
| 7.3 Pädagogische Zeitschriften | 365 | ||
| 7.4 Onlineressourcen | 367 | ||
| 7.4.1 Lehrpläne und Bildungsstandards | 367 | ||
| 7.4.1.1 Bayern | 367 | ||
| 7.4.1.2 Baden-Württemberg | 368 | ||
| 7.4.1.3 Hessen | 368 | ||
| 7.4.1.4 Nordrhein-Westfalen | 369 | ||
| 7.4.1.5 Kultusministerkonferenz | 369 | ||
| 7.4.1.6 Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen | 369 | ||
| 7.4.1.7 Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband | 370 | ||
| 7.4.2 Onlinedokumente | 370 | ||
| 7.4.3 YouTube Videos | 371 | ||
| 7.5 Reden | 372 | ||
| 7.6 Lieder | 373 | ||
| 7.7 Bilder | 374 | ||
| 7.8 Filme | 375 | ||
| 7.9 Tabellarische Übersicht der lateinischen Vergleichstexte | 376 | ||
| 7.9.1 Kapitel 1 | 376 | ||
| 7.9.2 Kapitel 2 | 376 | ||
| 7.9.3 Kapitel 3 | 377 | ||
| 7.9.4 Kapitel 4 | 379 | ||
| 7.9.5 Kapitel 5 | 380 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish