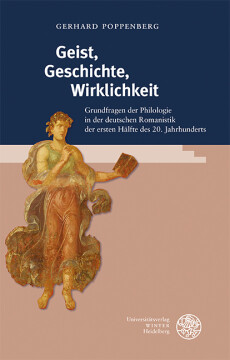
BUCH
Geist, Geschichte, Wirklichkeit
Grundfragen der Philologie in der deutschen Romanistik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
2022
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Die Darstellung ist konzeptueller Art; sie wird auf mehreren Ebenen entfaltet. Ausgehend von der historischen Situation, dem Leben der vorgestellten Romanisten – Vossler, Auerbach, Curtius, Spitzer –, geht es um die Romanistik als philologische Disziplin: um Sprach- und Literaturwissenschaft im Kontext des Historismus. Das ergibt Reflexionen zur Philologie allgemein im Rahmen der Geisteswissenschaften und, als letzte Schicht, zur Geschichtlichkeit der Geisteswissenschaften. Die Arbeiten der vier Philologen sind im Horizont der europäischen Geschichte von der griechisch-jüdisch-römischen Antike über das christliche Mittelalter bis zur neuzeitlichen Moderne angesiedelt, getragen von einem starken Begriff der Geschichtlichkeit Europas. Die Philologie als Methode bildet ein kritisches Bewusstsein der Probleme historischer Erkenntnis aus und schärft die historische Urteilskraft.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhalt | 7 | ||
| I Einleitung – Philologie und Hermeneutik | 23 | ||
| Geschichtsraum Europa – „europäische Philologen“ | 23 | ||
| Romanistik, Komparatistik, Exil | 28 | ||
| Klassische Philologie im 19. Jahrhundert | 30 | ||
| „philosophischer Gehalt“ des Streits | 34 | ||
| Usener – historischer Begriff der Wissenschaft | 37 | ||
| Boeckh – „Idee der Philologie“ | 40 | ||
| Schleiermacher – Stil als individuelles Sprechen | 43 | ||
| Schuchardt – individueller Grund geistiger Prozesse | 45 | ||
| Dilthey – persönliches Erlebnis und geistige Konfiguration | 50 | ||
| Bergson – Denken als Interaktion mit der Umwelt relational und okkasionell | 55 | ||
| Simmel – Identität als Zusammen von Verschiedenem | 58 | ||
| Cassirer – Substanzlogik und Funktionslogik | 64 | ||
| Troeltsch – „das logische Problem der Geschichtsphilosophie“ | 70 | ||
| Kontinuität in der Diskontinuität | 74 | ||
| II Karl Vossler – Sprache und Denken | 77 | ||
| 1 Leben – ‚eine Universität ist keine Menagerie‘ | 77 | ||
| „vielleicht der erste Romanist Deutschlands“ und „eigentlicher Neuerer derSprachwissenschaft“ | 77 | ||
| Kritik des Nationalismus und Rassismus | 81 | ||
| „Kristallisationskern der verfolgten Romanisten“ | 84 | ||
| 2 Sprache und Stil – ‚Urbild des modernen Menschen‘ | 89 | ||
| Sprachstil und Denkstil in Cellinis ‚Vita‘ | 89 | ||
| Croce und Vossler über Sprache, Fühlen und Denken | 95 | ||
| Croces ‚Ästhetik‘ – intuitive und logische Erkenntnis | 100 | ||
| Aretinos „Bekenntnisse“ | 106 | ||
| Leopardi gegenmodern | 109 | ||
| 3 Grammatik und Gedanke – ‚Geschichte der geistigen Ausdrucksformen‘ | 117 | ||
| Stil und Geschmack als Momente des Allgemeinen | 117 | ||
| Sprachrichtigkeit und Wahrheit | 122 | ||
| Kunst als Gestalt gewordene Geschichte | 129 | ||
| Inkarnation des Geistes in der Sprache | 136 | ||
| „Gesinnungsgemeinschaft“ und Bildung von Allgemeinheitsfiguren | 145 | ||
| 4 Sprachwandel und Kulturwandel – ‚auf neue Bahnen hingeschleudert‘ | 150 | ||
| Sprachwissenschaft, „Sprachgeschmack“, Geistesgeschichte | 150 | ||
| „Künstlerkampf“ zwischen Dichtung und Form | 153 | ||
| Hochlatein, Vulgärlatein, romanische Sprachen | 157 | ||
| ‚Frankreichs Kultur und Sprache‘ exemplarisch | 162 | ||
| 5 Moderne und Gegenmoderne – ‚der spanische Zustand der modernen Menschheit‘ | 169 | ||
| Vosslers Wende nach Spanien | 169 | ||
| Händler und Eroberer, Bürger und Abenteurer | 175 | ||
| Lope de Vega und der „Persönlichkeitsbegriff“ der Spanier | 180 | ||
| Poesie der Einsamkeit und Quietismus | 187 | ||
| III Erich Auerbach – Figur und Geschichte | 191 | ||
| 1 Leben – ‚die Gunst des Schicksals‘ | 191 | ||
| Bürgerliche Herkunft, Exil, Ruf nach Ostberlin | 191 | ||
| Assimiliertes jüdisches Elternhaus und bürgerlicher Bildungsgang | 194 | ||
| 2 Methode – ‚man muss lernen, sorgsam zu lesen‘ | 198 | ||
| Keine theoretische Grundlegung | 198 | ||
| 3 Vico – ‚die ewige ideale Geschichte‘ | 203 | ||
| Auerbach und Vico – „Geschichtlichkeit des Geistes“ | 203 | ||
| Elemente der Mathematik und der Geschichtswissenschaft | 206 | ||
| Zivilisation und Geschichte als Natur des Menschen | 209 | ||
| Universale fantastico und poetische Theologie | 213 | ||
| Poetische Bildungen, Gesetz, Vergesellschaftung | 216 | ||
| Anthropologischer Zirkel und Providenz | 218 | ||
| 4 Weltliteratur – ‚Geschichte der zum Selbstausdruck gelangten Menschheit‘ | 222 | ||
| Vico und „Idee der Philologie“ | 222 | ||
| Historisch-anthropologischer Zirkel | 226 | ||
| Differenz von antikem und christlichem Europa | 229 | ||
| Eulalia-Hymnus des Prudentius und ‚sermo humilis‘ | 232 | ||
| Schrift- und Geschichtsdeutung figural | 235 | ||
| 5 Mimesis – ‚der Leib der Zeit‘ | 240 | ||
| Auerbachs Europazentrismus | 240 | ||
| Hermeneutik und Tradition der Bibelexegese | 244 | ||
| Geschichtsphilosophischer Gehalt | 250 | ||
| Moralisch-ethische ‚coincidentia oppositorum‘ | 254 | ||
| „triumphierendes irdisches Leben“ | 256 | ||
| Möglichkeiten und Grenzen von Auerbachs Fragestellung | 260 | ||
| 6 Geschichtsontologie – ‚der Sprung ins Erhabene‘ | 263 | ||
| Herr-Knecht-Figur als ‚universale fantastico‘ | 263 | ||
| Erhabenes säkular religiös | 266 | ||
| Gottesfurcht, Frömmigkeit, Weisheit | 269 | ||
| IV Ernst Robert Curtius –Topos und Allotria | 273 | ||
| 1 Leben – ‚alles andere als ein Klassizist‘ | 273 | ||
| Traditionswahrung und Restaurationsideologie | 273 | ||
| ‚Ulysses‘ exemplarisch modern | 275 | ||
| Rückbesinnung auf die Tradition als Möglichkeit zur Erneuerung | 278 | ||
| 2 Methode – Verflechtung von Erbe und Neuwerden | 282 | ||
| Topoi als „Urverhältnisse des Daseins“ | 282 | ||
| Imitation und Innovation | 285 | ||
| Topos und Pathosformel | 288 | ||
| Liebe als Kristallisation (Stendhal) | 292 | ||
| „Urverhältnisse des Daseins“ (Curtius) und „Urgedanken“ (Schelling) | 294 | ||
| 3 Historische Topologie – ‚reale Teilhabe an einem geistigen Sein‘ | 298 | ||
| „Verständnis der abendländischen Tradition“ | 298 | ||
| „reale Teilhabe“ am „geistigen Sein“ der Überlieferung | 303 | ||
| Geschichte, Naturzusammenhang, Göttin Natura | 305 | ||
| Diskussion über Manierismus | 309 | ||
| Tiefenstrukturen der Moderne | 313 | ||
| „leitmotivische Polyphonie“ | 315 | ||
| 4 Philologie und Erkenntnis – ‚die herbe Chronik der Geschichte‘ | 318 | ||
| Atomgitter und Sprachgitter | 318 | ||
| Schatzhaus der Tradition in beständigem Umbau | 322 | ||
| Schiffbruch des Odysseus in Dantes ‚Inferno‘ | 325 | ||
| Baudelaire: unendlicher Wunsch nach Neuem, Schiffbruch als Erfüllung | 328 | ||
| Witzel und Leopardi: metaphysischer Schiffbruch | 334 | ||
| Dämonisches und Psychotisches | 337 | ||
| V Leo Spitzer – Denken und Wirklichkeit | 343 | ||
| 1 Leben – ‚sein‘ Mein Kampf ‚sozusagen‘ | 343 | ||
| „Rabelaissche Haltung und unüberwindlicher Sarkasmus“ | 343 | ||
| Sprache und Literatur | 348 | ||
| Methode und persönlichen Einschlag | 355 | ||
| Satorische Haltung | 355 | ||
| „verehrungsvolle Gegnerschaft“ und ‚symphilologein‘ | 358 | ||
| 2 Sprache und Stil – ‚Halbwirklichkeit, ins Unwirkliche ragend‘ | 361 | ||
| Parallelaktion von Sprach- und Literaturwissenschaft | 361 | ||
| Dynamik von Form und Bedeutung | 365 | ||
| „Wortphantastik“ und Wirklichkeit | 368 | ||
| Vossler, Spitzer, Racine | 373 | ||
| Stil, Persona, individuelles Allgemeines | 377 | ||
| Argot und „Encanaillierungssucht der höheren Kreise“ | 380 | ||
| 3 Methode – ‚talent, experience and faith‘ | 385 | ||
| Habitus im Umgang mit Sprache und Dichtung | 385 | ||
| „schöne Geister“ und „Gelehrte“ | 389 | ||
| Natur, Werk, Übernatur | 393 | ||
| Wortwandel, Seelenwandel, Kulturwandel | 395 | ||
| 4 Rabelais – ‚abstracteur de quint essence‘ | 400 | ||
| Wortspiel, Neologismus, „Begegnung mit dem Unbekannten“ | 400 | ||
| Rabelais und französische Geistesgeschichte | 404 | ||
| Geistige Welt als Bildung des menschlichen Geistes | 411 | ||
| Rabelais‘ „Ort in der Ideengeschichte“ | 415 | ||
| Universalienstreit | 418 | ||
| Verfassung der Allgemeinbegriffe | 418 | ||
| 5 Geistesgeschichte und historische Semantik – ‚homo ideans‘ | 426 | ||
| „Entwicklungslinien verschiedener Ideen“ und „historische Semantik“ | 426 | ||
| Literaturgeschichte und Ideengeschichte | 430 | ||
| Romantik und deutscher Faschismus | 434 | ||
| Ideen in ‚historia‘ | 439 | ||
| 6 Weltharmonie – ‚Seelenheimatlaut‘ | 441 | ||
| Theologie und Philologie, Providenz und Geschichte, Weltordnung Gottes und Ordnung der Geschichte | 441 | ||
| Lovejoys Ideengeschichte der Kette der Wesen | 443 | ||
| Menschliche Bildung und spekulative Deutung | 445 | ||
| Willensfreiheit, Geschichte | 445 | ||
| Verzeitlichung des Harmoniegedankens und Geschichtsdenken | 451 | ||
| VI Ausblick – Dissemination und Deutung | 459 | ||
| Humanismus, Sprache, Literatur | 459 | ||
| Wahrheit und sprachliche Richtigkeit | 463 | ||
| Kritik der Unterscheidung von ‚langue‘ und ‚parole‘ | 467 | ||
| Poetik, Linguistik, Semiotik | 469 | ||
| Sachgehalt, Verstehen, Andersverstehen | 474 | ||
| Strukturalismus, Dekonstruktion, Aufklärung | 476 | ||
| „Schulbegriff“ und „Weltbegriff“ des Denkens | 483 | ||
| Dissemination und traditionelles Wort- und Bedeutungsfeld | 486 | ||
| Stile und Stil; Geschichten und Geschichte | 488 | ||
| Ontologie von wahrer und scheinbarer Welt | 492 | ||
| VII Explicit | 495 | ||
| VIII Bibliographie | 497 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish