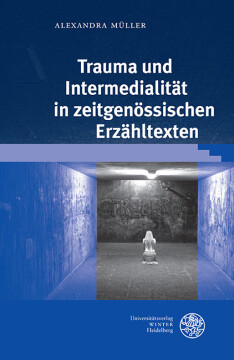
BUCH
Trauma und Intermedialität in zeitgenössischen Erzähltexten
Beiträge zur Literaturtheorie und Wissenspoetik, Bd. 9
2017
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Trauma figuriert als Motiv prominent in der Gegenwartsliteratur und ist als Deutungsmuster für das Verständnis zeitgenössischer Erzähltexte essentiell geworden. Diese Studie geht dabei von der These aus, dass sich insbesondere Intermedialität als probate Strategie erweist, um die Vielschichtigkeit von Traumareaktionen darzustellen. Als Grundlage der Untersuchung dienen deutsch-, englisch- und französischsprachige Erzähltexte, die Bild-Text-Relationen wie Ekphrasen, Fototexte oder die Ikonizität der Schrift einsetzen, um Repräsentationsmöglichkeiten von traumatischen Erfahrungen auszuloten. Anhand von detaillierten Einzelanalysen wird aufgezeigt, wie intermediale Übersetzungsprozesse die kommunikativen Schwierigkeiten der Vermittlung von traumatischer Erfahrung nachbilden, Symptome wie Erinnerungsstörungen textuell simulieren oder Sprachlosigkeit und Schweigen durch den Bezug auf das Medium der bildenden Kunst visuell wahrnehmbar machen. Die Arbeit wurde mit dem Dr.-Herbert-Stolzenberg-Award for the Study of Culture 2017 der Justus Liebig-Universität Gießen ausgezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | Cover | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Danksagung | 279 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| 1 Themenfeld und theoretische Prämissen | 9 | ||
| 2 Traumadiskurs | 23 | ||
| 2.1 Trauma im Zeugenstand: Eine kurze medizinisch-rechtliche Genealogie des Konzepts | 23 | ||
| 2.2 Eine Phänomenologie traumatischer Symptome | 27 | ||
| 2.2.1 Erinnerungsstörungen als Folge traumatischer Ereignisse | 30 | ||
| 2.2.2 „Car je est un autre“: Veränderte Welt- und Selbstwahrnehmung | 32 | ||
| 2.3 „Never simply one’s own“: Grundlagen der ‚Cultural Trauma Studies‘ | 34 | ||
| 2.4 Trauma in der Literatur: Möglichkeiten einer (literarischen) Darstellung | 43 | ||
| 2.4.1 Traumatexte und Texte über Traumata | 45 | ||
| 2.4.2 Literarische Zeugenschaft | 52 | ||
| 2.5 Aktuelle Trends in der Traumaforschung | 57 | ||
| 2.5.1 Kulturelle und kollektive Traumata | 58 | ||
| 2.5.2 Trauma in der Literaturwissenschaft | 61 | ||
| 2.5.2.1 Trauma als neuer Schlüsselbegriff des Postkolonialismus? | 63 | ||
| 2.5.2.2 Trauma als biopolitische Maßnahme? | 65 | ||
| 3 Intermedialität | 69 | ||
| 3.1 Mediendiskurs: Annäherung an den Begriff des Mediums und an das Konzept der Intermedialität in den Medienwissenschaften | 70 | ||
| 3.2 Literaturwissenschaftliche Intermedialität | 76 | ||
| 3.2.1 Explizite und implizite intermediale Bezugnahmen | 77 | ||
| 3.2.2 Ekphrasis | 81 | ||
| 3.3 Medienkombination | 86 | ||
| 3.3.1 Fototexte | 87 | ||
| 3.3.2 Multimodalität | 93 | ||
| 3.4 Trauma und Intermedialität | 96 | ||
| 3.4.1 Trauma und Fotografie | 99 | ||
| 3.4.2 Fototexte und Trauma | 102 | ||
| 4 Nachträglichkeit: Erinnerung an ein Kindheitstrauma in John Banvilles ‚The Sea‘ | 107 | ||
| 4.1 Intermediale Bezüge in ‚The Sea‘ | 111 | ||
| 4.1.1 Narration vs. Deskription: Beschreiben und Erzählen im Zusammenhang mit traumatischer Erinnerung | 113 | ||
| 4.1.2 „I think I am becoming my own ghost“: Kunstzitate als Ausdruck der Desintegration des Individuums | 115 | ||
| 4.2 Pikturalistische Strategien der literarischen Bilderzeugung | 118 | ||
| 4.2.1 „ Memory dislikes motion“: Max Morden als Erinnerungsmaler | 119 | ||
| 4.2.2 Bürgerliche Idylle: Das Interieur als sakraler Erinnerungsort | 123 | ||
| 4.2.3 Überbelichtung: Nachträglichkeit und Wiederholungsdrang | 126 | ||
| 4.3 Ekphrasis als Totenbeschwörung | 128 | ||
| 4.3.1 Ekphrasis I: „As if looking would hold her here“ | 130 | ||
| 4.3.2 Ekphrasis II: Fotografie als Reflexion des Todes | 133 | ||
| 4.4 „Someone has just walked over my grave“: Max Morden als literarischer Wiedergänger | 137 | ||
| 5 Medienkombination und traumatische Erinnerung in ‚Extremely Loud & Incredibly Close‘ | 141 | ||
| 5.1 Das Ereignis 9/11 und seine visuelle Repräsentation | 145 | ||
| 5.2 Intermedialität in ‚Extremely Loud & Incredibly Close‘: Die Sprache der Bilder und die Ikonizität der Schrift | 149 | ||
| 5.2.1 Die semantische Ebene der Fotografien | 151 | ||
| 5.2.2 „If I could tell you“: Typografische Sprachlosigkeit im Angesicht des Traumas | 155 | ||
| 5.2.3 „My life story was spaces“: Die Sichtbarmachung des Schweigens | 160 | ||
| 5.3 Der ‚Falling Man‘: „The pixels are so big that it stops looking like a person“ | 163 | ||
| 5.4 Oskars Daumenkino: „If I’d had more pictures, he would’ve flown through a window“ | 165 | ||
| 5.5 The Ethics of Love: Das Trauma im Roman und im Film | 170 | ||
| 6 Undarstellbarkeit: Die Visualität des Schweigens und des Unsichtbaren | 175 | ||
| 6.1 Visuelle Leerstellen als strategisch eingesetzte Erzählelemente: Schwarz… | 178 | ||
| 6.2 …auf weiß oder Wie der leere Grund zum Vordergrund wurde | 184 | ||
| 6.2.1 Intermedialer Erinnerungsdiskurs in ‚Das Eigentliche‘: Formen der Gedenkpraxis in der Bundesrepublik | 186 | ||
| 6.2.2 Tabula Rasa: Das unbeschriebene Blatt als polyvalente Leerstelle | 191 | ||
| 6.3 Fotografien als produktive Lücke im textuellen Umfeld | 195 | ||
| 6.3.1 Der Ikonotext als Inszenierung einer präsenten Absenz: Camille Laurens’ ‚Cet Absent-Là‘ | 198 | ||
| 6.3.2 Fotografische Leerstellen und Phantombilder in ‚Cet Absent-Là‘ | 200 | ||
| 7 Janice Williamsons ‚Crybaby!‘: Das Familienalbum als Ort des Traumas | 207 | ||
| 7.1 Sie haben das Recht zu schweigen: Das vielschichtige Schweigediktat in ‚Crybaby!‘ | 211 | ||
| 7.1.1 Persönliches Schweigen: Wer ‚ich‘ sagt… | 211 | ||
| 7.1.2 Gesellschaftliches Schweigen: Die ‚Memory Wars‘ der 1990er Jahre | 214 | ||
| 7.1.3 Literarische Nachkriegszeit: „When are there too many war stories?“ | 220 | ||
| 7.1.4 „Your life has taken place between the lines“: Kommunikative visuelle und auditive Leerstellen in ‚Crybaby!‘ | 222 | ||
| 7.2 It’s all in the photograph: Text als Bild – Bild als Text | 225 | ||
| 7.2.1 Kindheitsfotos als soziale Rollenerfüllung: Verdeckter Missbrauch in den 1950er Jahren | 226 | ||
| 7.2.2 Swing Memory: Der ontologische Status des Traumas zwischen Fantasie und Realität | 228 | ||
| 7.3 „The Space Pain Makes“: Tatort Körper | 230 | ||
| 8 Ausblick: Intermedialität als diskursive Strategie engagierter Literatur? | 239 | ||
| 9 Literaturverzeichnis | 249 | ||
| 9.1 Primärliteratur | 249 | ||
| 9.2 Sekundärliteratur | 250 | ||
| 9.3 Filmverzeichnis | 278 | ||
| 9.4 Verzeichnis der Siglen | 278 | ||
| Backcover | 280 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish