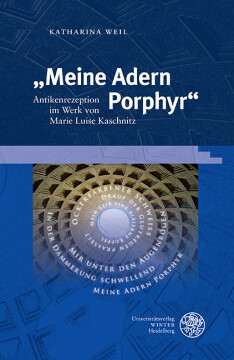
BUCH
„Meine Adern Porphyr“
Antikenrezeption im Werk von Marie Luise Kaschnitz
Beiträge zur Literaturtheorie und Wissenspoetik, Bd. 10
2017
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Die vorliegende Studie ist die erste breiter angelegte, systematische Untersuchung zur Rezeption der Antike und der Stadt Rom im Œuvre von Marie Luise Kaschnitz. Auch unter Einbezug bislang nicht ausgewerteten Materials und noch nahezu unbeachtet gebliebener Quellen widmet sie sich im ersten Teil der Verarbeitung antiker Mythen und deren Landschaften im Frühwerk der Autorin zwischen den 1930er und 1940er Jahren und im zweiten Teil ihren literarischen Rom-Bildern ab 1947 bis 1972. Die Texte werden erstmalig in ihrer Gesamtkomposition und als Ausdruck eines zeitspezifischen und dabei kultur- wie zeitkritischen Antikenrekurses gelesen. Die Arbeit bindet die ausgewählten Passagen dazu gezielt in kulturhistorische, geistesgeschichtliche und wissenschaftliche Kontexte sowie in entsprechende ästhetische Diskurse ein und geht entscheidenden Entwicklungslinien und Transformationsprozessen nach. Auch die Funktionalisierung differenter Gattungsformen sowie intertextueller und intermedialer Verfahren wird dabei in den Blick genommen.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | C | ||
| Titel | iii | ||
| Impressum | iv | ||
| Inhaltsverzeichnis | v | ||
| Vorwort | xvii | ||
| 1 Einleitung | 1 | ||
| 2 1936–1945: Zeit- und kulturkritische Arbeit am Mythos und an der südlichen Topographie | 15 | ||
| 2.1 Voraussetzungen | 15 | ||
| 2.1.1 „Meine Fragelust […] war ungeheuer.“ Der biographische Bildungshorizont | 15 | ||
| 2.1.2 Kulturhistorische und altertumswissenschaftliche Hintergründe: Zwischen „moderner Bewußtheit und Sehnsucht nach archaischem Glück“ | 20 | ||
| 2.1.2.1 „Mythos ist […] etwas vom ‚Ursprung‘ […]“. Der Zugang zu mythischen Sujets vor der Folie von Walter F. Otto, Karl Kerényi und C. G. Jung | 20 | ||
| 2.1.2.2 Weitere Beispiele für die Verarbeitung mythologischer Stoffe zwischen 1930 und 1945 | 29 | ||
| 2.1.2.3 Die Zeitkrise der 1920er und 1930er Jahre als Kontext für die Rückkehr zum Mythos und zum Ursprünglichen | 31 | ||
| 2.1.2.4 Exemplarische Analyse des Essays ‚Mythos‘ | 41 | ||
| 2.1.2.5 Einflüsse aus dem Ende des 19. Jahrhunderts: Friedrich Nietzsche und Johann Jakob Bachofen | 49 | ||
| 2.1.2.5.1 Marie Luise Kaschnitz im Bannkreis der Enthüller einer „dunklere[n] und wildere[n] Antike“ | 49 | ||
| 2.1.2.5.2 Die Komplementärbeziehung von Dionysischem und Apollinischem bei Nietzsche | 62 | ||
| 2.1.2.5.3 Bachofens Vorstellung einer „successive[n] Läuterung des Lebens“ und sein Bild von der Frau | 68 | ||
| 2.1.2.5.4 Die Rezeption Bachofens im Nationalsozialismus | 74 | ||
| 2.1.3 „[…] das war unsere Art von Widerstand […].“ Die Konstruktion von Gegenwelten des Ewigen und Geistigen im Kontext der „Inneren Emigration“ | 79 | ||
| 2.1.3.1 „An der Wichtigkeit unserer Arbeit zweifelten wir keinen Augenblick […].“ Leben und Schreiben in der Diktatur | 79 | ||
| 2.1.3.2 Literarische Verfahren und Techniken: Mythenrezeption als ein „Schreiben zwischen den Zeilen“ | 87 | ||
| 2.1.3.3 Spezifische Erzählräume: Die Zeitlosigkeit südlicher Natur und antiker Kunstlandschaft | 93 | ||
| 2.2 Fragehorizonte | 97 | ||
| 2.3 Der Roman ‚Elissa‘: Eine Narration über die Macht des mythologischen Erzählens | 98 | ||
| 2.3.1 Exposition: „Die Geschichte dieser Königin war es, die Elissa vor allem liebte.“ | 98 | ||
| 2.3.1.1 Äußere Struktur und inhaltlicher Aufbau des Romans | 98 | ||
| 2.3.1.2 Fragehorizont, methodische Überlegungen und Thesen | 100 | ||
| 2.3.2 Ausgestaltung des narrrativen Raums | 110 | ||
| 2.3.3 „Ich bin anders als du […]. Es ist etwas Dunkles in mir, dem ich nicht wehren […] will.“ Zum Polaritätsprinzip zwischen Anna und Elissa | 112 | ||
| 2.3.3.1 Der Manuskriptentwurf ‚Die Irrenden‘ | 112 | ||
| 2.3.3.2 Der Untergrund einer elementar-ursprünglichen Frauen- und Mutterwelt | 114 | ||
| 2.3.3.3 „[…] cum sic unanimam adloqitur […] sororem […].“ | 117 | ||
| 2.3.3.4 Das Verhältnis der Schwestern zu Erzählungen und Imagination | 123 | ||
| 2.3.3.5 Divergierende Vorstellungen von Weiblichkeit | 125 | ||
| 2.3.3.6 Annäherungen an die Wesensart Annas | 131 | ||
| 2.3.4 „Es war alles ein Irrtum, dachte sie plötzlich.“ Die radikale ‚Umwertung‘ des Dido-Mythos | 134 | ||
| 2.3.4.1 ‚Heterodiegetische Transformation‘: „Elissa lachte, weil es ihr einfiel, mit jenem sagenhaften Geschehen die jämmerliche Landung des Fremden zu vergleichen.“ | 134 | ||
| 2.3.4.2 ‚Demotivation‘: „haerent infixi pectore vultus / verbaque […].“ – „Einmal lag auch in Worten Glück, aber das war vor langer Zeit.“ | 138 | ||
| 2.3.4.3 „Noch immer war ihm das Schicksal der Siedlung gleichgültig.“ Die Entheroisierung der Aeneas-Gestalt | 142 | ||
| 2.3.4.4 Unter dem Gehorsam einer „Stimme, die nicht ihr allein gehörte, sondern allen Frauen der Welt“. Die Neubelebung eines Identitätsverlustes vor der Folie Bachofens und des nationalsozialistischen Frauenbildes | 146 | ||
| 2.3.4.5 Elissas ‚Aufbruch‘ zum eigenen Ich als zeitkritische Pervertierung der ‚Hypotexte‘ | 153 | ||
| 2.3.5 „Oft kleidete der Alte seine Belehrung in das Gewand von Gleichnissen und Märchen.“ Narratologische Konzeption und Selbstreferentialität | 160 | ||
| 2.3.5.1 Erzähltechnische Verfahren der Leserlenkung | 160 | ||
| 2.3.5.1.1 Nullfokalisierung: „In diesem Herbst entwurzelte der Sturm den großen Baum […]. Elissa und Anna wußten es nicht.“ | 160 | ||
| 2.3.5.1.2 Zukunftsgewisse Vorausdeutungen in Erzähler- und Figurenrede | 164 | ||
| 2.3.5.2 „Während die Mutter erzählte, sah sie sich selbst […] an der Brüstung eines Schiffes stehen […].“ Das Zurücktreten in die mythologische Urzeit | 169 | ||
| 2.3.6 Fazit | 180 | ||
| 2.4 Lyrische Reisen ins Mythisch-Ursprüngliche: Der Gedichtzyklus ‚Südliche Landschaft‘ | 182 | ||
| 2.4.1 Exposition: Italien- und Griechenlandbilder als Chiffre des Übergeschichtlichen | 182 | ||
| 2.4.2 Literarische Vorbildung: Das kulturkritische Griechenland-Tagebuch Ernst Wilhelm Eschmanns | 183 | ||
| 2.4.3 Begegnungen mit dem „Auge der Urwelt“ | 186 | ||
| 2.4.4 „Weht von campanischen Ufern mir lichte Gewähr.“ Überdauernde Gegenwerte | 191 | ||
| 2.4.5 Das Gedicht ‚Delphi‘ als Neubelebung eines Gründungsmythos | 195 | ||
| 2.4.5.1 Exposition: Ein „Maß im Zusammenklang von hell und dunkel, im Gleichgewicht von oben und unten“ | 195 | ||
| 2.4.5.2 Textanalyse | 199 | ||
| 2.4.5.2.1 Gaia und Dionysos | 199 | ||
| 2.4.5.2.2 Zeus und Apoll | 205 | ||
| 2.4.5.2.3 Ein „Bündnis von Rausch und Licht“ | 210 | ||
| 2.4.6 Fazit | 211 | ||
| 2.5 Zwischen Höhle und Idee: Die Sammlung ‚Griechische Mythen‘ | 212 | ||
| 2.5.1 Die Grundstruktur eines immerwährenden Auf- und Abstiegs | 212 | ||
| 2.5.2 Die Zwiegestalt des Mythischen | 223 | ||
| 2.5.2.1 Sibylle und Demeter | 223 | ||
| 2.5.2.2 Perseus und Bellerophontes | 234 | ||
| 2.5.3 Der poetologische Horizont einer „dionysische[n] Verschmelzung“ | 244 | ||
| 2.5.3.1 Hephaistos und die Thebanischen Zwillinge | 244 | ||
| 2.5.3.2 Didaktische Überformung: Der mythische Erzieher Chiron | 256 | ||
| 2.5.4 Fazit | 262 | ||
| 2.6 Der Triumph der Kunst in „dunkler Zeit“: Poetische Selbstreflexion und Standortbestimmung im Skulptursonett ‚Nike‘ von ‚Samothrake‘ | 263 | ||
| 2.6.1 Exposition | 263 | ||
| 2.6.2 Gedichtanalyse | 269 | ||
| 2.6.2.1 „Und schlug doch hellen Jubel aus dem Stein.“ Die Entstehung einer ‚Textskulptur‘ auf dem „Untergrund des Schreckens“ | 269 | ||
| 2.6.2.2 „Und lehrt […] des Sieges unvergleichliche Gebärde“. Die mythische Vermittlung künstlerischen Selbstbewusstseins | 277 | ||
| 2.6.3 Fazit und Gesamtrückschau | 282 | ||
| 3 1947–1972: Rom-Imaginationen. Bilder ästhetischer Selbstverortung | 285 | ||
| 3.1 Folien: Zeitgenössische Rom-Konzeptionen | 285 | ||
| 3.1.1 Literarische Topographie: Rom als Text | 285 | ||
| 3.1.1.1 Erste Begegnung mit den Schriftwegen durch die Ewige Stadt | 285 | ||
| 3.1.1.2 Geschichte der Lesbarkeit Roms | 288 | ||
| 3.1.1.3 „Rom ist […] eine Toten-Stadt […].“ Revoltierende Gegentexte gegen die bedeutenden ‚Vorschriften‘. | 295 | ||
| 3.1.2 Kulturhistorische Rom-Gänge der Moderne und ihre Spuren in der Gegenwartsliteratur | 302 | ||
| 3.1.2.1 Eine „Verschmelzung des Differentesten“. Rom bei Georg Simmel | 302 | ||
| 3.1.2.2 Sigmund Freuds „Utopie einer lebendigen […] Erinnerung“. Rom als permanente Gegenwart von Vergangenem | 305 | ||
| 3.1.2.3 „Die Schrift der Architektur.“ Literarische Wege durch Rom als Analogien zur simultanen Durchdringung des „Differentesten“ | 306 | ||
| 3.1.3 ‚Romanità fascista‘: Rom als Hauptstadt des Faschismus | 308 | ||
| 3.1.4 ‚Ritorno all’uomo‘: Gegenentwürfe im neorealistischen Film der frühen Nachkriegszeit | 314 | ||
| 3.2 Fragehorizonte | 319 | ||
| 3.3 Der Essay ‚Rom‘ als „Textraum der Memoria“ | 322 | ||
| 3.3.1 Exposition: Rom als überzeitliche Landschaft von Natur, Kunst und Vergangenheit | 322 | ||
| 3.3.1.1 Die Erstveröffentlichung des Essays in der Zeitschrift ‚Das Kunstwerk‘ | 322 | ||
| 3.3.1.2 Fragehorizonte und Thesen | 323 | ||
| 3.3.1.3 „Das Herzklopfen damals […], Roma, Rom.“ Der magische Moment der Ankunft | 325 | ||
| 3.3.2 „Mit der Nennung des Namens beginnt jede Beschwörung.“ Die Zauberkraft des Bezeichnens | 327 | ||
| 3.3.3 „Wer Rom denkt […].“ Rom als imaginäre Textstadt | 330 | ||
| 3.3.4 „Hier bin ich und dort, draußen vor den Toren und im Herzen der Stadt zugleich.“ Textuelle Macht über die römische Topographie | 335 | ||
| 3.3.5 „Manchmal belebt sich die Bühne des großen Welttheaters mit den Gestalten versunkener Zeiten.“ Eine Topologie der römischen Geschichte | 340 | ||
| 3.3.6 „Kapitelle […], vom lichten Bambusgesträuch überweht.“ Der Essay ‚Rom‘ als elementarer Zyklus von Werden und Vergehen | 351 | ||
| 3.3.7 Der Abschied von den alten Schriftwegen als erste Neupositionierung literarischer Identität in Rom | 362 | ||
| 3.3.8 Fazit | 363 | ||
| 3.4 „Reden die Steine, tönen die Masken noch […]?“ Der Gedichtzyklus ‚Ewige Stadt‘ zwischen Aufbegehren und Affirmation | 365 | ||
| 3.4.1 Exposition: Lyrische Wanderung durch Ruinen dekonstruierter Rom-Bilder und Topographien der ‚Wiedergeburt‘ | 365 | ||
| 3.4.1.1 Folien | 365 | ||
| 3.4.1.2 Fragehorizonte und Thesen | 368 | ||
| 3.4.2 Sprechhaltung und Form als Ausdruck einer brüchig gewordenen Rom-Erfahrung und Suche nach neuer Totalität | 373 | ||
| 3.4.3 „Vergeblich / Sucht Ihr die Lampen […].“ Rom im Dunkeln | 379 | ||
| 3.4.4 „Warum springen die Brunnen nicht mehr […]?“ Rom als Todeslandschaft und Topographie der Entfremdung | 381 | ||
| 3.4.5 „Sich selbst nicht mehr und keinem Menschen gleich.“ Die Menschenzeichnung im Gedichtzyklus | 387 | ||
| 3.4.6 „[…] seid Ihr noch immer da / Madonnen lächelnde […] Gebäumte Leiber der Sklaven?“ Auflehnung gegen die steinernen Schriften Roms | 392 | ||
| 3.4.7 „[…] wer liebte noch die Liebe?“ ‚Roma‘ ohne ‚Amor‘ | 397 | ||
| 3.4.8 Von der Dunkelheit ins Licht. Das dreizehnte Gedicht | 403 | ||
| 3.4.9 „Du Nicht-mehr-Du und Mehr-als-Du.“ Rom als Ort der Verwandlung | 408 | ||
| 3.4.9.1 Exposition: „,Qui non si muore mai‘.“ | 408 | ||
| 3.4.9.2 „Du liebst ja noch.“ Die Sprache der römischen Steine | 413 | ||
| 3.4.9.3 „Und branden hörst Du das Meer an die Mauern der Stadt […].“ Rom als innere Landschaft der Imagination | 423 | ||
| 3.4.10 „Es reden die Steine von Rom, blühend im Neonlicht […].“ | 431 | ||
| 3.4.11 Fazit | 438 | ||
| 3.5 „Die Bemühung um Einklang ist vergeblich […].“ Römische Fragmente im Tagebuch ‚Engelsbrücke‘ | 441 | ||
| 3.5.1 Exposition: Ich-Suche zwischen Antike und Zeitgenossenschaft | 441 | ||
| 3.5.2 „Es ist schwer, in Rom zu leben […].“ Die Programmatik der ersten Aufzeichnung und ihr Bezug zu autobiographischen Rom-Texten der Autorin aus den 1960er und 1970er Jahren | 447 | ||
| 3.5.3 Zwischen „Erde und Himmel“. Zur Titelwahl der ‚Römischen Betrachtungen‘ | 453 | ||
| 3.5.4 Bilder des Dauernden und „ewig Gleiche[n]“ im römischen „Durcheinander der Zeiten“ | 460 | ||
| 3.5.4.1 ‚San Urbano‘ | 460 | ||
| 3.5.4.2 ‚Das Muschelhorn‘ | 466 | ||
| 3.5.4.3 ‚Torre Pignattara‘ | 470 | ||
| 3.5.4.4 ‚Colosseum‘ | 474 | ||
| 3.5.4.5 „Taggespenster“ | 478 | ||
| 3.5.4.5.1 ‚Eine kleine Stadt‘ | 478 | ||
| 3.5.4.5.2 ‚Parco della Rimembranza‘ | 480 | ||
| 3.5.4.5.3 Zwei Streifzüge über den Palatin | 482 | ||
| 3.5.4.6 Neue Arbeiten am Mythos | 487 | ||
| 3.5.4.6.1 Exposition | 487 | ||
| 3.5.4.6.2 ‚Philemon und Baucis auf der Alm‘ | 492 | ||
| 3.5.4.6.3 ‚Das Labyrinth‘ | 496 | ||
| 3.5.4.6.4 „[…] und beinahe schon eine mythische Gestalt.“ Mythisierung des römischen Volkes | 506 | ||
| 3.5.4.7 Harmonischer Einklang in der Disharmonie | 509 | ||
| 3.5.5 Die ‚Engelsbrücke‘ als zeitgeschichtliches Panorama | 514 | ||
| 3.5.5.1 „Wer Synthese sagt, ist schon gebrochen.“ Zur literarischen Tagebuchform der ‚Römischen Betrachtungen‘ | 514 | ||
| 3.5.5.2 Die „Nadel in der Erdbebenwarte“: „[…] wir werden geschrieben.“ | 523 | ||
| 3.5.5.3 Rom als Gegenwart der Kriegsvergangenheit | 531 | ||
| 3.5.5.4 Kritik der Moderne in den ‚Römischen Betrachtungen‘ | 536 | ||
| 3.5.5.5 „Schattenwege gehen“ | 541 | ||
| 3.5.5.6 ‚Zu Ende‘ – Die letzte Aufzeichnung des Tagebuchs | 549 | ||
| 3.5.6 Fazit | 556 | ||
| 3.6 Römische Fülle in engmaschigen „Wortnetzen“. Die lyrischen Imaginationen Vorstadt, ‚Rom 1961‘ und ‚Römischer Sommer‘ | 559 | ||
| 3.6.1 Exposition | 559 | ||
| 3.6.2 Folien | 560 | ||
| 3.6.2.1 „Durch diese unsere / Kleinen Gebärden […].“ Eine ‚neue‘ Sprache für Rom | 560 | ||
| 3.6.2.2 „[…] Weht noch die feurige Asche […] Steigt aus dem treibenden Abschaum / Lächelnd die Schönheit.“ Das ‚Nachbeben‘ der Mythen in den ‚Neuen Gedichten‘ | 565 | ||
| 3.6.3 „Hohlwege voll von / Blühendem Ginster.“ Das Gedicht ‚Vorstadt‘ | 572 | ||
| 3.6.3.1 Exposition: Thesen und Blick auf die äußere Gestaltung | 572 | ||
| 3.6.3.2 Gedichtanalyse | 573 | ||
| 3.6.3.2.1 „Nur noch zwei Bäume / Sind übrig vom / Hain der Egeria […].“ Szenerien eines Welt- und Sprachverlustes | 573 | ||
| 3.6.3.2.2 „Vielstöckige Häuser / Kommen gelaufen […].“ Die moderne Großstadt Rom als surrealistische Topographie | 575 | ||
| 3.6.3.2.3 „[…] die schwarzen / Zypressen die / Mückenteiche […].“ Neue Zeichnungen der ,Rettung‘ im fruchtbaren Umland Roms | 578 | ||
| 3.6.4 „Und Cypria Weltherz Du / Geschlagen gebeutelt gepreßt / Verschenkst Deinen leuchtenden Honig.“ ‚Rom 1961‘ | 580 | ||
| 3.6.4.1 Im Bann der „dynamisierte[n] Fläche“. Begegnung mit den Kunststipendiaten der Villa Massimo | 580 | ||
| 3.6.4.2 Gedichtanalyse | 584 | ||
| 3.6.4.2.1 Der lyrische Raum Rom als „Träger einer explosiven Bewegung“ | 584 | ||
| 3.6.4.2.2 „Ich lerne Dich lieben, auch so.“ | 590 | ||
| 3.6.5 „Schwer zu pressen ins Wortnetz / Die Fülle des frühzeitigen Sommers […].“ Der späte Gedichtzyklus ‚Römischer Sommer‘ | 594 | ||
| 3.6.5.1 „Ihr graugesichtig am Steuer / In die Enge Getriebene […].“ Das Leiden der römischen Stadtbewohner | 594 | ||
| 3.6.5.2 Römische Metamorphosen als Gegenbilder: Die Verschmelzung des lyrischen Ich mit römischer Natur und antiker Architektur | 599 | ||
| 3.6.5.2.1 Der Beginn: „Ein Arm schon Oleander“ | 599 | ||
| 3.6.5.2.2 „Mein Leib eine bleierne Kuppel […] Meine Adern Porphyr.“ Das lyrische Ich als römisches Bauwerk | 605 | ||
| 3.6.5.2.3 Erdung der Luftgeister: „Wer schon enthoben sich glaubte [...], hier wird er angepflockt / Sein Langhaar an Säule und Ölbaum.“ | 610 | ||
| 3.6.6 Fazit | 617 | ||
| 3.7 Zwischen Wort- und Bildkunst. Die Gedichte ‚Picasso in Rom‘, ‚Villa Massimo‘ und ‚Abschied von Rom‘ | 620 | ||
| 3.7.1 Exposition | 620 | ||
| 3.7.2 Text-Bild-Beziehungen in der Dichtung des 20. Jahrhunderts | 622 | ||
| 3.7.3 „Die leidende / Klarheit / Abend.“ Das Bildgedicht ‚Picasso in Rom‘ | 624 | ||
| 3.7.3.1 Fragehorizont und Thesen | 624 | ||
| 3.7.3.2 Folie: Deformationen der Welt in Picassos Werk der 1940er und 1950er Jahre und ihre Rezeption in der autobiographischen Prosa bei Kaschnitz | 626 | ||
| 3.7.3.3 Gedichtanalyse | 631 | ||
| 3.7.3.3.1 „Zerrissenen / Vogel im Zahn.“ Semantische und formalästhetische Realisierung der Bildkunst Picassos | 631 | ||
| 3.7.3.3.2 Der „wundgefetzte“ Außenraum | 638 | ||
| 3.7.4 „Ich will mir ein Bild machen […].“ Das lyrische Ich als Künstler der Villa Massimo | 643 | ||
| 3.7.4.1 Exposition | 643 | ||
| 3.7.4.2 Gedichtanalyse | 645 | ||
| 3.7.4.2.1 „Vorgefunden zwei Staffeleien […].“ Die poetologische Dimension des lyrischen Atelierraums | 645 | ||
| 3.7.4.2.2 „Mein Fluß wird seinen Lauf / Willkürlich ändern […].“ Ein abstraktes ,Textgemälde‘ der römischen Villa Massimo | 649 | ||
| 3.7.5 Abschied von Rom | 654 | ||
| 3.7.5.1 „Orte mir lange bekannte / Sterben ab […].“ | 654 | ||
| 3.7.5.2 „Strandgut […] Ewigkeit […].“ Die unendliche Textkette Roms | 660 | ||
| 3.7.5.3 „Vielmehr ich bin’s […].“ Ästhetische Selbstpositionierung in der poetischen Landschaft der Ewigen Stadt | 663 | ||
| 3.7.6 Fazit | 672 | ||
| 4 Gesamtfazit | 677 | ||
| 5 Anhang | 691 | ||
| 5.1 Siglenverzeichnis und Hinweise zur Zitation | 691 | ||
| 5.1.1 Marie Luise Kaschnitz | 691 | ||
| 5.1.1.1 Werkausgabe | 691 | ||
| 5.1.1.2 Weitere Werke | 691 | ||
| 5.1.2 Sonstiges | 692 | ||
| 5.1.3 Allgemeine Hinweise zur Zitation | 692 | ||
| 5.2 Literaturverzeichnis | 692 | ||
| 5.2.1 Quellen | 692 | ||
| 5.2.2 Forschungsliteratur | 698 | ||
| 5.2.2.1 Zu Marie Luise Kaschnitz | 698 | ||
| 5.2.2.2 Zum altertumswissenschaftlichen und kulturhistorischen Kontext zwischen den 1920er und 1940er Jahren | 703 | ||
| 5.2.2.3 Zur „Inneren Emigration“ | 705 | ||
| 5.2.2.4 Zur Mythen- und Antikenrezeption | 707 | ||
| 5.2.2.5 Zu Rom, Italien und Griechenland in der Literatur | 712 | ||
| 5.2.2.6 Spezifische Untersuchungen zur Narratologie, Intertextualität und Intermedialität | 717 | ||
| 5.2.2.7 Weitere Untersuchungen | 718 | ||
| 5.2.2.8 Nachschlagewerke | 728 | ||
| 5.3 Register zu historischen Personen und Figuren des Mythos | 730 | ||
| Backcover | 739 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish