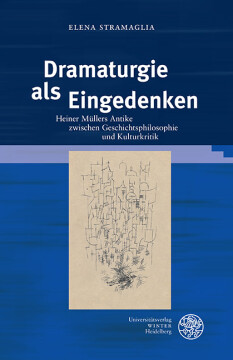
BUCH
Dramaturgie als Eingedenken
Heiner Müllers Antike zwischen Geschichtsphilosophie und Kulturkritik
Beiträge zur Literaturtheorie und Wissenspoetik, Bd. 17
2020
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Heiner Müllers Antikedramen reflektieren nicht nur einen kritischen Umgang mit Aspekten der westlichen Literaturtradition, sondern einen umfassenderen Denkkomplex um Geschichte, Mythos und Kultur. Bei der Gestaltung dieses Horizonts spielt der philosophische Dialog mit Walter Benjamin, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno eine entscheidende Rolle. Die Monographie untersucht, wie diese intertextuelle Reflexion sich mit der Praxis der Antikerezeption verbindet und wie sie in den Dramen in literarisch vielfältiger Methodik dargestellt und problematisiert wird. Neben den theoretischen Prämissen des Dialogs werden dessen Wirkungen in drei Stücken in Augenschein genommen: Philoktet, Ödipus Tyrann und Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten. Anhand der Texte werden die politisch-geschichtliche Tragweite von Müllers Arbeit an Mythos und Tragödie, deren geschichtsphilosophische Prägung sowie ihre kulturkritische Funktion analysiert.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Einleitung: Heiner Müller, Antike und Mythos | 7 | ||
| I Philosophisch-ästhetische Grundlagen | 17 | ||
| 1 Heiner Müller und Walter Benjamin (I): Zeit und Geschichtlichkeit, Utopie und Katastrophe | 17 | ||
| 1.1 Engelbilder | 17 | ||
| 1.2 Benjamins Geschichtsbild: die Thesen ‚Über den Begriff der Geschichte‘ | 20 | ||
| 1.3 Müllers Geschichtsauffassung auf der Folie von Benjamins Denken | 30 | ||
| 1.4 Geschichtliche Dramaturgie | 38 | ||
| 2 Heiner Müller und Walter Benjamin (II): Mythos-Theorien | 45 | ||
| 2.1 Mythos, Tragödie und Recht im Frühwerk Walter Benjamins | 45 | ||
| 2.2 Mythos-Begriff in Benjamins materialistischen Schriften | 53 | ||
| 2.3 Müllers ‚benjaminscher‘ Begriff des Mythos | 59 | ||
| 3 Heiner Müller und die Frankfurter Schule | 67 | ||
| 3.1 Horkheimers und Adornos ‚Dialektik der Aufklärung‘ | 67 | ||
| 3.2 Dialektik der Aufklärung im Denken Heiner Müllers | 74 | ||
| II Dramenanalysen | 79 | ||
| 4 ‚Philoktet‘ | 79 | ||
| 4.1 Über Heiner Müllers ‚Philoktet‘ | 79 | ||
| 4.2 Perspektiven der Interpretation | 82 | ||
| 4.3 Politik als Schicksal: von der ‚Durchrationalisierung‘ des Stücks zur sozialistischen Deutung | 84 | ||
| 4.4 Vernunft und Natur, Aufklärung und Gesellschaft | 91 | ||
| 4.5 Welche Tragik? | 97 | ||
| 4.6 ‚Ironie‘ des Mythos | 106 | ||
| 4.7 Das Kontinuum aufsprengen: Eingedenken statt Wiederholung | 111 | ||
| 5 ‚Ödipus Tyrann‘ | 115 | ||
| 5.1 ‚Ödipus‘, kommentiert | 115 | ||
| 5.2 »Ich und kein Ende«: Doppelcharakter und Selbstüberhebung des Ödipus | 118 | ||
| 5.3 »Tyrann durch Verdienst«: Dialektik der Souveränität | 122 | ||
| 5.4 Die ‚süße‘ Selbstblendung und die Trennung von Theorie und Praxis | 126 | ||
| 5.5 Menschheitsgeschichtliche Parabel des Ödipus. Benjaminsche Anklänge | 131 | ||
| 5.6 Dialektik von Aufklärung und Mythos | 133 | ||
| 5.7 Ödipus und Odysseus | 137 | ||
| 5.8 Die sozialistische Deutung | 142 | ||
| 6 ‚Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten‘ | 147 | ||
| 6.1 Medea-Drama, Medea-Dramen | 147 | ||
| 6.2 ‚Verkommenes Ufer‘ | 148 | ||
| 6.3 ‚Medeamaterial‘ | 153 | ||
| 6.4 ‚Landschaft mit Argonauten‘ | 163 | ||
| 6.5 Dialektik von Mythos und Aufklärung im Stück | 171 | ||
| 6.6 Von der mythischen Zirkularität zur Revolution der Erinnerung. Nach Benjamin | 179 | ||
| 6.7 Fragment, Allegorie, Zeitraffer: Müllers »konstruktiver Defaitismus« | 189 | ||
| Antike und Erinnerung. Einige abschließende Überlegungen | 203 | ||
| Bibliografie | 209 | ||
| Primärliteratur – Werke von Heiner Müller | 209 | ||
| Weitere Primärliteratur | 214 | ||
| Sekundärliteratur | 219 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish