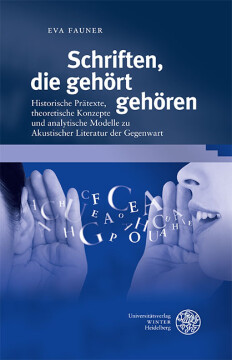
BUCH
Schriften, die gehört gehören
Historische Prätexte, theoretische Konzepte und analytische Modelle zu Akustischer Literatur der Gegenwart
Beiträge zur Literaturtheorie und Wissenspoetik, Bd. 19
2021
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Die Studie widmet sich der Kunstgattung ‚Akustische Literatur‘, die bisher nur in Ansätzen analysiert und literaturtheoretisch gewürdigt worden ist. Sie versammelt phono-graphische Texte, die sich gleichermaßen an Ohr wie Auge richten und zwischen Stimme und Schrift angesiedelt sind: Lesetexte loten im Medium der Schrift stimmlich-akustische Phänomene aus, Stimmtexte verlauten in Anlage und Ausführung ihre schriftliche Genese. Ziel dieser Arbeit ist es, die historischen, poetologischen, medialen und performativen Bedingungen von Akustischer Literatur zu systematisieren. So werden Entwicklungslinien von Akustischer Literatur nachgezeichnet und gegenwärtige Phänomene literarischer Praktiken und Formate verhandelt, die auf medialen Interferenzen von Stimme und Schrift basieren. Die theoretischen Erwägungen münden in konkrete Textanalysen von Akustischer Literatur der Gegenwart – es sind dies ‚Ereignisse‘ von Thomas Bernhard, ‚Vox Feminarum‘ von Elfriede Jelinek und ‚Sprecht!‘ von Markus Köhle.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | C | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Danksagung | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| 1 Einleitung | 11 | ||
| 1.1 Streifzug durch die gegenwärtige literarische Klanglandschaft | 11 | ||
| 1.2 Ausgangspunkte, Ziele, Fragestellungen | 15 | ||
| 1.3 Struktur der Studie | 18 | ||
| 2 Zur historischen Genese von Akustischer Literatur: literarische und poetologische Prätexte | 21 | ||
| 2.1 ‚Stimme der Schrift‘: Re-Oralisierung von Wahrnehmung und Literatur um 1800 | 22 | ||
| 2.1.1 Johann Gottfried Herder: „Tönende Sprache“ | 23 | ||
| 2.1.2 Für das Sprechen schreiben: Deklamationspraxis um 1800 | 27 | ||
| 2.1.3 Friedrich Gottlieb Klopstock: „Doppelte Tonbildung“ | 30 | ||
| 2.1.4 Zum medialen Bewusstsein der Romantik: Ludwig Tieck, Friedrich Schlegel, Clemens Brentano | 35 | ||
| 2.1.5 Novalis: „TonSchriftkunst“ | 40 | ||
| 2.1.6 Fazit | 45 | ||
| 2.2 ,Schrift der Stimme‘: Phonograph und Klangaufzeichnung um 1900 | 46 | ||
| 2.2.1 Hugo von Hofmannsthal: „Phonogramme“ | 48 | ||
| 2.2.2 Rainer Maria Rilke: „Ur-Geräusch“ | 52 | ||
| 2.2.3 Thomas Mann: „Wohllaut“ | 55 | ||
| 2.2.4 Fazit | 58 | ||
| 3 Theoretische Ankerpunkte im ‚medialen Ereignis‘ Akustische Literatur: Medialität und Performativität von Stimme und Schrift | 61 | ||
| 3.1 Medialität: Stimme und Schrift | 62 | ||
| 3.1.1 De-Dichotomisierung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit: Stimme und Schrift im Kontinuum von medialer und konzeptueller Verfasstheit | 62 | ||
| 3.1.2 Der starke Medienbegriff Akustischer Literatur | 65 | ||
| 3.1.3 Von Jacques Derridas „Schrift der Stimme“ zu Petra Maria Meyers „Graphophonie“ | 72 | ||
| 3.2 Performativität: Akustische Literatur im Licht der Performance | 76 | ||
| 3.2.1 John L. Austin: „How to do things with words“ | 77 | ||
| 3.2.2 Zur performativen Ästhetik von Akustischer Literatur am Beispiel der ‚Wiener Gruppe‘ | 79 | ||
| 3.3 Intermedialität: Schreiben hören und Sprechen lesen | 83 | ||
| 3.3.1 Mediale Interferenz und Differenz: Marshall McLuhans „Hybridisierung“ und Niklas Luhmanns „Differenzfunktion“ | 85 | ||
| 3.3.2 Roland Barthes: „écriture à haute voix“ – das ‚laute‘ Schreiben | 89 | ||
| 3.4 Vom ‚lauten Schreiben‘ zum ‚medialen Ereignis‘: ‚Sound Systems Caterpillar‘ der „Shelter Performance Group“. Ein literarisches Fazit | 93 | ||
| 4 Der Gattungsbegriff und Gattungsmerkmale von Akustischer Literatur | 99 | ||
| 4.1 Zum Gattungskonzept und zur Gattungskonstituierung von Akustischer Literatur | 99 | ||
| 4.1.1 Gattungsfragen, Denkrichtungen, Forschungsansätze | 99 | ||
| 4.1.2 Akustische Literatur als Gattung: Begründung durch Klaus Schöning und Reinhard Döhl | 105 | ||
| 4.1.3 Variationen in der Begriffsverwendung von Akustischer Literatur | 109 | ||
| 4.2 Gattungsdefinition und poetische Strategien von Akustischer Literatur | 115 | ||
| 5 Akustische Literatur der Gegenwart in Text und Ton: Modellanalysen | 119 | ||
| 5.1 ‚Er schreibt wie er spricht‘/‚Er spricht wie er schreibt‘. Die Stimme der Schrift in ‚Ereignisse‘ von Thomas Bernhard | 120 | ||
| 5.1.1 Texttypologische Merkmale und das Making-Of der bimedialen Edition | 120 | ||
| 5.1.2 O-Ton Bernhard | 124 | ||
| 5.1.3 ‚Unerhörte Begebenheiten‘. Das Erzählmodell der Novelle als ästhetisches Movens der ‚Ereignisse‘ | 127 | ||
| 5.1.4 Repetition und Variation: Der Bernhardsche Sprachrhythmus | 133 | ||
| 5.2 „und ich spreche über nichts sonst als diese Schrift“. Zur Überlagerung von Stimme und Schrift in ‚VOX FEMINARUM‘ von Elfriede Jelinek, Ernst M. Binder und Josef Klammer | 141 | ||
| 5.2.1 Texttypologische Merkmale und das Making-Of der bimedialen Edition | 141 | ||
| 5.2.2 Paramediale Rahmenanalyse | 145 | ||
| 5.2.3 Stockende Stimme, scheiternde Schrift | 147 | ||
| 5.2.4 Von der Manipulation der Erzählstimme zur Demontage der AutorInnenlesung | 151 | ||
| 5.3 ‚Schreiben, um gehört zu werden‘. Die Schrift der Stimme in Slam-Poetry am Beispiel von Markus Köhles ‚Sprecht!‘ | 156 | ||
| 5.3.1 Texttypologische Merkmale und das Making-Of der bimedialen Edition | 156 | ||
| 5.3.2 Schriftstimmliche Hybridität | 161 | ||
| 5.3.3 Fingierte Mündlichkeit: Sprachliche Rhythmen und Klänge in Köhles ‚Sprecht!‘ | 163 | ||
| 5.3.4 Inszenierte Schriftlichkeit: Zur akustischen Textperformanz von Köhles ‚Sprecht!‘ | 166 | ||
| 6 Conclusio | 175 | ||
| 7 Biblio- und Diskographie | 181 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish