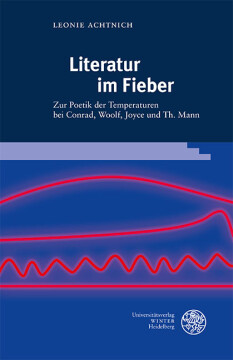
BUCH
Literatur im Fieber
Zur Poetik der Temperaturen bei Conrad, Woolf, Joyce und Th. Mann
Beiträge zur Literaturtheorie und Wissenspoetik, Bd. 20
2021
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Eine Schlüsselmetapher der Literatur des frühen 20. Jahrhunderts ist das Fieber, dem als Überschreitung der Normaltemperatur kulturelle Symbolkraft zukommt. Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung stehen Fieberdarstellungen aus dieser Umbruchszeit: ansteckendes Tropenfieber in Joseph Conrads Novelle ‚The Shadow-Line. A Confession‘ (1917), transformatives Fieber in Virginia Woolfs The Voyage Out (1915), wiederkehrendes Fieber in James Joyce’ ‚A Portrait of the Artist as a Young Man‘ (1916) und chronisches Fieber in Thomas Manns ‚Der Zauberberg‘ (1924). Diese Fiebernarrative bringen gleichermaßen Schreibverfahren der krisenhaften Auflösung wie solche der produktiven Neuschöpfung hervor. Das Fieber wird so als poetologische Metapher etabliert, die aus der Medizin in die Literatur eingeht und textuelle Strategien zur Darstellung und Überwindung von Krisen ausstellt. Durch die Einbettung des Fiebers in das Metaphernfeld der Temperaturen leistet die Arbeit einen wertvollen Beitrag zur Kulturpoetik der Moderne.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Danksagung | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Einleitung | 9 | ||
| 1 Fiebernde Körper und fiebernde Texte | 21 | ||
| 1.1 Der subversiv fiebernde Körper | 21 | ||
| 1.2 Fieber als poetologische Metapher | 33 | ||
| 1.3 Zur poetologischen Bedeutung des Fiebers um 1900 | 39 | ||
| 2 Ansteckende Fieber in Joseph Conrads ‚The Shadow-Line‘ | 45 | ||
| 2.1 Die Erzählsituation in ‚The Shadow-Line‘ | 47 | ||
| 2.2 Der Fieberdiskurs im Tropenkontext | 50 | ||
| 2.3 Das Zusammenspiel von Temperatur und Handlung | 55 | ||
| 2.4 Ansteckende Erzählverfahren | 60 | ||
| 2.5 Verfall oder Disziplin: Mr Burns und Ransome | 63 | ||
| 2.6 Das Fieber als Bedrohung des Erzählens | 67 | ||
| 2.7 Fieber- und Erzählkrise | 70 | ||
| 3 Transformatives Fieber in Virginia Woolfs ‚The Voyage Out‘ | 77 | ||
| 3.1 ‚On Being Ill‘ und die Poetik des literarischen Krankseins | 81 | ||
| 3.2 Unterschwellige, äußere und innere Hitze | 85 | ||
| 3.3 ‚The Voyage Out‘ und ‚Daisy Miller‘ | 92 | ||
| 3.4 Poetik des Lesens unter dem Einfluss der Hitze | 95 | ||
| 3.5 Grenzgänge und Wendepunkte | 97 | ||
| 3.5.1 Infektion: die Reise zum Ursprung | 97 | ||
| 3.5.2 Intertextuelle Ansteckung: Miltons ‚Comus‘ | 101 | ||
| 3.5.3 Infektion der Erzählverfahren | 104 | ||
| 3.6 Nach dem Fieber: Rückkehr zur Normaltemperatur | 109 | ||
| 4 Wiederkehrendes Fieber in James Joyces ‚A Portrait of the Artist as a Young Man‘ | 115 | ||
| 4.1 „A queer feeling“: körperorientiertes Erzählen | 120 | ||
| 4.2 Fieber und Sprache in der Krankheitsepisode | 123 | ||
| 4.3 Hitze, Begehren und Lust | 126 | ||
| 4.3.1 „Hot tears“: Schmerz und Sprache | 126 | ||
| 4.3.2 „An incommunicable emotion“: verstecktes Begehren | 128 | ||
| 4.3.3 „Unrest“: auf- und abflammendes Begehren | 130 | ||
| 4.4 Verbotenes Fieber: Hitzebilder in der Predigt | 132 | ||
| 4.5 Ausbruch aus der Askese: verdrängte Hitze | 135 | ||
| 4.6 Ein Fieber der Sprache | 139 | ||
| 5 Chronisches Fieber in Thomas Manns ‚Der Zauberberg‘ | 143 | ||
| 5.1 Das Zauberbergfieber im kulturellen Kontext | 148 | ||
| 5.2 Hitze und Verdrängung: Manifestationen des Seelenlebens | 151 | ||
| 5.3 Infektion und Abweichung: der Textanfang | 155 | ||
| 5.4 Ausbruchsfantasien: Fieber als Gesellschaftsflucht | 159 | ||
| 5.5 Fieberextreme: Mynheer Peeperkorn | 164 | ||
| 5.6 Sprachliche Verfahren der Fiebersenkung | 167 | ||
| 5.6.1 Fieberdiagnostik und Begriffsschwierigkeiten | 168 | ||
| 5.6.2 Das Thermometer als fiebernder Körper | 170 | ||
| 5.7 Das „Fieber der Materie“ als poetologische Reflexion | 174 | ||
| 5.8 Die chronische Fieberkrise | 177 | ||
| Schlussbetrachtung | 183 | ||
| Literaturverzeichnis | 189 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish