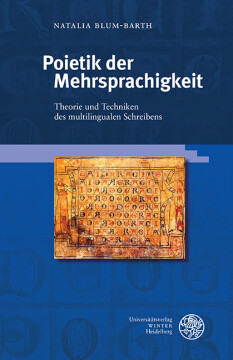
BUCH
Poietik der Mehrsprachigkeit
Theorie und Techniken des multilingualen Schreibens
Beiträge zur Literaturtheorie und Wissenspoetik, Bd. 21
2021
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Diese Studie versteht sich als eine dezidiert poetologische Betrachtung mehrsprachiger literarischer Phänomene unter historischen, formalen und generischen Aspekten. Sie geht der Frage nach den Bedingungen, den Produktions- und Gestaltungsprinzipien nach und untersucht das mehrsprachige Schreiben als eine Sonderform literarischer Poiesis. Literarische Mehrsprachigkeit wird als Ergebnis einer multilingualen sprachlichen Konzeption und Organisation des Textes definiert. Darauf aufbauend wird ein innovativer Konzeptualisierungsansatz angeboten, der über bisherige Ansätze hinausgeht und neue Perspektiven insbesondere auf Formen verdeckter Mehrsprachigkeit eröffnet. Darüber hinaus werden verschiedene Ebenen und Spielformen der Einwirkung der Sprachen auf einander erörtert und die Gestaltbarkeit von Sprache und Sprachen als essentielle Voraussetzung literarischer Arbeit veranschaulicht.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Dank | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Einleitung | 11 | ||
| Teil I: Eine kleine Geschichte der literarischen Mehrsprachigkeit | 23 | ||
| 1 „Wo der Stimm komm her?“: Antike | 23 | ||
| 2 Zwischen „Babylonischer Verwirrung“ und Pfingstwunder: Literarische Mehrsprachigkeit im Mittelalter und in der Renaissance | 26 | ||
| 3 Im Spannungsfeld der Sprachmischung und des Purismus: Neuzeit | 31 | ||
| 4 Die Herausbildung der Nationalsprachen: Romantik und Realismus | 34 | ||
| 5 Von der Sprachskepsis zur Mehrsprachigkeit? Moderne | 36 | ||
| 6 Exil: Sprachprobleme, Sprachwechsel, Zweisprachigkeit | 42 | ||
| 7 Von der Wende zum Wandel: Literarische Mehrsprachigkeit nach 1989 | 47 | ||
| 7.1 1980 bis Ende 1980er: Von der Solidarisierung zur Anerkennung: Die Blütezeit der Gastarbeiterliteratur | 48 | ||
| 7.2 1987 bis Anfang der 2000er: Sprache der Identitätssuche und des Dialogs | 53 | ||
| 7.3 2000 bis 2010: Normierung vs. Individualisierung der Sprache. Poetiken als Protest gegen Digitalisierung | 56 | ||
| 7.4 2010 bis 2018: Literarische Mehrsprachigkeit zwischen Experiment und Gesellschaftskritik | 58 | ||
| Teil II: Formen und Funktionen der literarischen Mehrsprachigkeit | 61 | ||
| 1 Formen der literarischen Mehrsprachigkeit. Versuch einer Typologie | 61 | ||
| 1.1 Einige Bemerkungen zur Begriffsvielfalt und Begriffsklärung | 61 | ||
| 1.2 Textübergreifende/textexterne literarische Mehrsprachigkeit | 66 | ||
| 1.3 Textinterne literarische Mehrsprachigkeit und ihre Formen | 69 | ||
| 1.3.1 Manifeste literarische Mehrsprachigkeit | 70 | ||
| 1.3.2 Latente literarische Mehrsprachigkeit | 77 | ||
| 1.3.3 Exkludierte literarische Mehrsprachigkeit | 85 | ||
| 2 Funktionen der literarischen Mehrsprachigkeit | 88 | ||
| 2.1 Sprachmischung, fremdsprachige Einsprengsel und ihre Funktionen im literarischen Text | 89 | ||
| 2.2 Veränderte Rahmenbedingungen: Manifeste literarische Mehrsprachigkeit und ihre Funktionen | 93 | ||
| 2.3 Funktionen der latenten literarischen Mehrsprachigkeit | 98 | ||
| 2.4 Exkludierte literarische Mehrsprachigkeit als ‚neue Mehrsprachigkeit‘? | 102 | ||
| Teil III: Techniken des mehrsprachigen Schreibens | 105 | ||
| 1 Metamultilingualismus | 105 | ||
| 1.1 Sprachkommentierung | 107 | ||
| 1.2 Sprachvergleich | 112 | ||
| 1.3 Verfremdung der Sprache | 116 | ||
| 1.4 Inszenierung der Sprache | 121 | ||
| 1.5 Exotisierung der Sprachen | 123 | ||
| 1.6 Selbstreflexion | 128 | ||
| 2 Übersetzung | 135 | ||
| 2.1 Übersetzung als neue Denkfigur und Technik des mehrsprachigen Schreiben | 135 | ||
| 2.2 „Schreiben als Übersetzung“ bei Yoko Tawada | 138 | ||
| 2.3 Thematische Markierung der Übersetzung | 142 | ||
| 2.3.1 Figuren: Dolmetscher, Übersetzer, Sprachlehrer | 142 | ||
| 2.3.2 Übersetzungsfehler und Übersetzungsdiskurs | 146 | ||
| 2.3.3 Das Wörterbuch als Motiv und Metapher in der mehrsprachigen Literatur | 151 | ||
| 2.4 Sprachliche Umsetzungen der Übersetzung | 157 | ||
| 2.4.1 Paraphrasierte Übersetzung: Parallelität der Sprachen | 157 | ||
| 2.4.2 Verschlüsselte Übersetzung: Sprechende Namen | 161 | ||
| 2.4.3 Verdeckte Übersetzung: Sprachlatenz | 168 | ||
| 3 Intertextualität | 174 | ||
| 3.1 Intertextualität und interlinguales Zitieren bei Herta Müller | 175 | ||
| 3.1.1 Intertextuelle Verfahren als Mittel der Identifikation | 176 | ||
| 3.1.2 Interlinguales Zitieren als Ausdruck der ,Beschädigung‘ | 185 | ||
| 3.1.3 Intertextuelle Bezugnahmen zur rumänischen Literatur | 192 | ||
| 3.2 Intertextualität bei Vladimir Nabokov | 197 | ||
| 3.2.1 Das Spiel mit Nähe und Distanz zu literarischen Vorbildern | 198 | ||
| 3.2.1.1 Markierung der Intertextualität | 198 | ||
| 3.2.1.2 Formen der Intertextualität | 201 | ||
| 3.2.2 Funktionen der Intertextualität | 208 | ||
| 3.2.2.1 Intertextualität als Verhandlungsraum literarischer Vorbilder | 209 | ||
| 3.2.2.2 Schreibstrategische Funktion der Intertextualität | 216 | ||
| Teil IV: Mehrsprachigkeit bei Vladimir Nabokov | 223 | ||
| 1 Literarische Mehrsprachigkeit im Roman ‚Ada‘ | 223 | ||
| 1.1 Russisch: Von der favorisierten zur verworfenen Sprache? | 227 | ||
| 1.2 Französisch als Bildungs- und Kultursprache | 234 | ||
| 1.3 Deutsch: Von der abgelehnten zur abfälligen Sprache | 237 | ||
| 1.4 Fachsprache der Botanik | 239 | ||
| 1.5 Sprache der Bilder | 240 | ||
| 2 Mehrsprachige Wortspiele als Form der Sprachensynchronisierung | 241 | ||
| 2.1 Zur Definition des Wortspiels | 243 | ||
| 2.2 Nabokovs mehrsprachiges Schreiben als Spiel | 244 | ||
| 2.2.1 Vom Schach- zum Sprachspiel | 247 | ||
| 2.2.2 Der Spiegel als Denk- und Spielfigur | 251 | ||
| 2.2.3 Schmetterlinge und Naturspiele bei Nabokov | 255 | ||
| 2.3 Form und Funktion mehrsprachiger Wortspiele bei Nabokov | 259 | ||
| 2.3.1 Phonetische Schreibung als Technik der Verschränkung der Sprachen | 262 | ||
| 2.3.2 Inkorporierung als Form des interlingualen Wortspiels | 269 | ||
| 2.3.3 Anagramm: Buchstabensynchronie als Spiel mit Verschlüsselungen | 277 | ||
| 2.3.4 Vom Buchstabenspiel zur Verschlüsselung: Poetik der Einschränkung | 287 | ||
| 3 Polyphoner Klang als Form der Sprachensynchronisierung | 297 | ||
| 3.1 Nabokov als Tonmeister | 299 | ||
| 3.1.1 Synästhesie im Dienst der Mehrsprachigkeit | 304 | ||
| 3.1.2 Das akustische Gedächtnis des Russischen | 307 | ||
| 3.2 Verfahren der Sprachensynchronisierung | 315 | ||
| 3.2.1 Die Inszenierung des falschen Tons: Akzent | 315 | ||
| 3.2.2 Die Imitation des russischen Klanges: R-Laut | 323 | ||
| 3.2.3 Die akustische Mimikry: interlinguale Homophone | 325 | ||
| 3.2.4 Die Ästhetisierung des Klanges | 330 | ||
| Schlussbemerkungen | 343 | ||
| Literaturverzeichnis | 347 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish