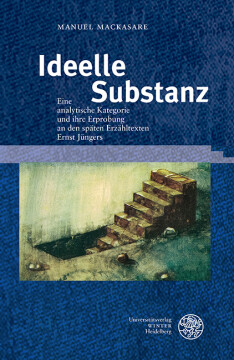
BUCH
Ideelle Substanz
Eine analytische Kategorie und ihre Erprobung an den späten Erzähltexten Ernst Jüngers
Beiträge zur Literaturtheorie und Wissenspoetik, Bd. 27
2024
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Eine erzählte Welt (Diegese) unterliegt eigenständigen Gesetzmäßigkeiten. Es handelt sich um ein Phänomen, das sich zum Verhältnis von empirischer Realität und Naturgesetz analog verhält und sich ähnlich wie dieses beobachten lässt. Das diegetische Gesetz wird hier als ideelle Substanz bezeichnet. Für die Analyse jedes schriftlichen Kunstwerks ist eine Feststellung seiner ideellen Substanz hochrelevant. Im ersten Teil der Studie erfolgen grundlegende begriffliche und konzeptuelle Fixierungen: hinsichtlich des Gegenstandes der Literaturwissenschaft, hinsichtlich Autor und Rezipient, hinsichtlich der Literaturwissenschaft selbst. Auf dieser Grundlage wird ideelle Substanz als Phänomen künstlerischer Texte wie auch als analytische Kategorie profiliert. Anschließend dient der zweite Teil dazu, das Gesagte zu illustrieren und zu erproben. Dafür werden Ernst Jüngers Erzähltexte ab 1939 auf ihre jeweilige ideelle Substanz hin analysiert.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | III | ||
| Impressum | IV | ||
| Zitat | V | ||
| Vorrede | VII | ||
| Inhaltsverzeichnis | XV | ||
| Einleitung | 1 | ||
| Erster Teil | 5 | ||
| I Der Gegenstand | 7 | ||
| 1 Werk: Beschaffenheit und Erkenntnis | 7 | ||
| 1.1 Definition und Grundzüge | 7 | ||
| 1.2 Zwischenbemerkung: Das Werk als Erkenntnisobjekt | 10 | ||
| 1.3 Eigenschaften und Erkenntnis | 16 | ||
| 1.4 Beschaffenheit | 18 | ||
| 1.5 Immaterielle Werke | 21 | ||
| 1.6 Randnote: Erzeuger und Schaffensprozess | 24 | ||
| 2 Schriftliche Werke | 26 | ||
| 2.1 Vorbemerkung: Sprache und Schrift | 26 | ||
| 2.2 Sprachliche Grundlagen | 29 | ||
| 2.3 Zwischenbemerkung: Sprache und Werk | 40 | ||
| 2.4 Sprachverstehen | 43 | ||
| 2.5 Spezifika schriftlicher Werke | 46 | ||
| 2.6 Rezeption schriftlicher Werke | 49 | ||
| 3 Schriftliche Kunstwerke | 51 | ||
| 3.1 Grundzüge der Kunst | 51 | ||
| 3.2 Grundzüge des schriftlichen Kunstwerks | 53 | ||
| 3.3 Zwischenbemerkung: Kunst und Anthropologie | 57 | ||
| 3.4 Randnote: Gattungen und „Gesamtwerke | 59 | ||
| II Faktor Mensch | 63 | ||
| 1 Anthropologische Grundlagen | 63 | ||
| 1.1 Vorbemerkung | 63 | ||
| 1.2 Die Phänomene des Innenlebens | 64 | ||
| 1.3 Grundzüge der Psyche | 66 | ||
| 1.4 Die Weltvorstellung | 73 | ||
| 1.5 Biologische Perspektiven | 76 | ||
| 1.6 Intersubjektivität | 79 | ||
| 2 Autor | 83 | ||
| 2.1 Autor und Erkenntnis | 83 | ||
| 2.2 Autorschaft als soziale Rolle | 85 | ||
| 2.3 Schaffensprozess | 86 | ||
| 2.4 „Autorintention“ | 89 | ||
| 3 Rezipient | 90 | ||
| 3.1 Rezeptionsästhetik | 90 | ||
| 3.2 Wissenschaftliche Literaturrezeption | 92 | ||
| III Literaturwissenschaft | 97 | ||
| 1 Erkenntnisinteresse | 97 | ||
| 2 Grundlagen literaturwissenschaftlicher Erkenntnis | 98 | ||
| 2.1 Prämisse | 98 | ||
| 2.2 Historisch-hypothetische Perspektive | 101 | ||
| 2.3 Grundlagen des Sinnverstehens | 104 | ||
| 2.4 Historische Kontexte | 107 | ||
| 2.5 Themen | 110 | ||
| 2.6 Stimmung | 112 | ||
| 2.7 Form | 117 | ||
| 3 Praxis der literarischen Analyse | 119 | ||
| 3.1 Basale Hypothesen | 119 | ||
| 3.2 Grundsätzliches Vorgehen | 121 | ||
| 3.3 Das Wesentliche | 123 | ||
| 3.4 Kontextanalyse | 126 | ||
| 3.5 „Geltungsprüfung“ | 127 | ||
| 3.6 Exkurs: Einheitliche Methodologie? | 129 | ||
| IV Ideelle Substanz | 133 | ||
| 1 Verortung des Phänomens | 134 | ||
| 1.1 Intuitive Annäherung | 134 | ||
| 1.2 Substantielles in der Weltvorstellung | 136 | ||
| 1.3 Substanz im schriftlichen Kunstwerk | 137 | ||
| 1.4 Ideelle Substanz als analytische Kategorie | 139 | ||
| 2 Beschaffenheit ideeller Substanz | 140 | ||
| 3 Ideelle Substanz in der literaturwissenschaftlichen Praxis | 145 | ||
| 4 Randnote: Ideelle Substanz als generelles Phänomen | 149 | ||
| Zweiter Teil | 151 | ||
| Vorbemerkung | 153 | ||
| I Auf den Marmorklippen | 157 | ||
| 1 Thema | 157 | ||
| 2 Diegese | 157 | ||
| 2.1 Topographie | 157 | ||
| 2.2 Historizität | 160 | ||
| 2.3 Figuren | 161 | ||
| 2.4 Mauretania | 174 | ||
| 2.5 Handlung | 176 | ||
| 3 Form und Fassungen | 182 | ||
| 4 Ideelle Substanz | 186 | ||
| II Heliopolis | 193 | ||
| 1 Thema | 193 | ||
| 2 Diegese | 193 | ||
| 2.1 Topographie | 193 | ||
| 2.2 Historizität | 196 | ||
| 2.3 Staat, Gesellschaft, Institutionen | 199 | ||
| 2.4 Handlung | 229 | ||
| 2.5 Unterthemen | 238 | ||
| 3 Form | 251 | ||
| 4 Fassungen | 254 | ||
| 5 Ideelle Substanz | 256 | ||
| III Die Eberjagd | 261 | ||
| 1 Thema | 261 | ||
| 2 Diegese | 261 | ||
| 2.1 Historizität und Handlung | 261 | ||
| 2.2 Figuren: Richard, Breyer, Moosbrugger | 261 | ||
| 2.3 Büchse und Eber | 263 | ||
| 3 Form und Fassungen | 265 | ||
| 4 Ideelle Substanz | 266 | ||
| IV Besuch auf Godenholm | 269 | ||
| 1 Thema | 269 | ||
| 2 Diegese | 269 | ||
| 2.1 Historizität | 269 | ||
| 2.2 Figuren | 269 | ||
| 2.3 Handlung | 277 | ||
| 3 Form | 286 | ||
| 4 Fassungen | 287 | ||
| 5 Ideelle Substanz | 288 | ||
| V Gläserne Bienen | 291 | ||
| 1 Thema | 291 | ||
| 2 Diegese | 291 | ||
| 2.1 Historizität | 291 | ||
| 2.2 Gesellschaft | 292 | ||
| 2.3 Technik | 295 | ||
| 2.4 Figuren | 300 | ||
| 2.5 Handlung | 309 | ||
| 2.6 Epilog | 313 | ||
| 3 Form | 314 | ||
| 4 Fassungen | 315 | ||
| 5 Ideelle Substanz | 316 | ||
| VI Die Zwille | 321 | ||
| 1 Thema | 321 | ||
| 2 Diegese | 321 | ||
| 2.1 Historizität | 321 | ||
| 2.2 Gesellschaft | 322 | ||
| 2.3 Figuren | 323 | ||
| 2.4 Handlung | 339 | ||
| 3 Form und Fassungen | 346 | ||
| 4 Ideelle Substanz | 350 | ||
| VII Eumeswil | 355 | ||
| 1 Thema | 355 | ||
| 2 Diegese | 355 | ||
| 2.1 Historizität | 355 | ||
| 2.2 Topographie | 357 | ||
| 2.3 Staat und Gesellschaft | 359 | ||
| 2.4 Technik | 371 | ||
| 2.5 Venator | 373 | ||
| 2.6 Venators Weltvorstellung | 379 | ||
| 2.7 Haupthandlung | 392 | ||
| 2.8 Nebenstränge | 398 | ||
| 3 Form und Fassungen | 409 | ||
| 4 Ideelle Substanz | 415 | ||
| VIII Aladins Problem | 421 | ||
| 1 Thema | 421 | ||
| 2 Diegese | 421 | ||
| 2.1 Historizität | 421 | ||
| 2.2 Gesellschaft | 422 | ||
| 2.3 Friedrich Baroh | 423 | ||
| 2.4 Handlung | 426 | ||
| 3 Form und Fassungen | 438 | ||
| 4 Ideelle Substanz | 442 | ||
| IX Eine gefährliche Begegnung | 445 | ||
| 1 Thema | 445 | ||
| 2 Diegese | 445 | ||
| 2.1 Historizität und Gesellschaft | 445 | ||
| 2.2 Figuren und Handlung | 446 | ||
| 2.3 Weitere Themen | 460 | ||
| 3 Form und Fassungen | 463 | ||
| 4 Ideelle Substanz | 465 | ||
| X Appendix | 467 | ||
| 1 Eins | 468 | ||
| 2 Numinoses | 469 | ||
| 3 Götter und Titanen | 471 | ||
| 4 Erde | 472 | ||
| 5 Ordnung | 473 | ||
| 6 Geschichte | 477 | ||
| 7 Gegenwart | 479 | ||
| 8 Prognosen | 481 | ||
| 9 Arbeiter | 482 | ||
| 10 Weltstaat | 484 | ||
| 11 Technik | 485 | ||
| 12 Zahlen | 487 | ||
| 13 Ost und West | 488 | ||
| 14 Gesellschaft | 488 | ||
| 15 Individuum | 490 | ||
| 16 Erkenntnis | 492 | ||
| 17 Symbole und Farben | 495 | ||
| 18 Kunst | 495 | ||
| 19 Autorschaft | 496 | ||
| Schluss | 499 | ||
| Synopse | 501 | ||
| Literaturverzeichnis | 513 | ||
| 1 Schriften Ernst Jüngers | 513 | ||
| 1.1 Erzählendes (Werkausgabe) | 513 | ||
| 1.2 Erzählendes (Erstausgaben) | 514 | ||
| 1.3 Essayistisches | 514 | ||
| 1.4 Diarisches | 516 | ||
| 1.5 Weiteres | 516 | ||
| 2 Allgemeines Literaturverzeichnis | 516 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish