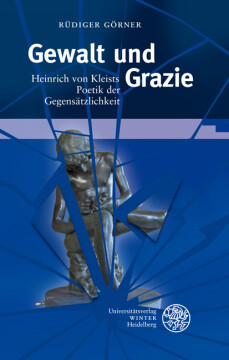
BUCH
Gewalt und Grazie
Heinrich von Kleists Poetik der Gegensätzlichkeit
Beiträge zur neueren Literaturgeschichte [Dritte Folge], Bd. 292
2012
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Diese Studie versucht, die Ästhetik des Gegensätzlichen in Kleists Werk als eines seiner zentralen Phänome in den Blickpunkt zu rücken und zu zeigen, wie Kleists Werke sich auch als poetische Entsprechungen zu Adam Müllers philosophischer Konzeption des Gegensatzes verstehen lassen. Dabei finden die Briefe Kleists, aber auch seine journalistischen Arbeiten und die oft übergangene Lyrik besondere Beachtung. Deutlicher als in anderen Studien zu Kleist soll hier auch die ironisch-parodistische Seite in seinem Schaffen berücksichtigt werden. Strukturiert ist diese Arbeit als eine Abfolge von Untersuchungen zu Konstellationen, die dieses Werk überwölben und durchdringen, zu motivisch-ästhetischen, meist konträren Werkpaarungen und für Kleist erheblichen Gattungsreflexionen, angeordnet in drei Teilen, die auch als ‚Akte’ einer intellektuellen Inszenierung gelesen werden können, ein Aspekt, der Kleists souveränen Sinn für szenisch-dramatische Wirkungen symbolisch spiegeln soll.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | C | ||
| Titelei | 1 | ||
| Inhalt | 7 | ||
| Kleistisches Proszenium: Gewalt, Kalkül und Grazie verstehen | 9 | ||
| Erster Teil / Akt: Ästhetische Konstellationen | 25 | ||
| I „Der einsame Mittelpunkt im einsamen Kreis“: Zur Geometrie von Kleists Ästhetik | 25 | ||
| II Ästhetische Psychologie der Gewalt und Grazie bei Kant, Schiller und Adam Müller | 39 | ||
| Exkurs I: Gegenwelt Idylle oder Mit den Grazien Staat machen. Christoph Martin Wielands Aufhebung der Gegensätze durch ästhetische Politik | 56 | ||
| Exkurs II: Kleists britische Gegenwelt | 66 | ||
| III Die Macht der Sprachkunst | 76 | ||
| Zweiter Teil / Akt: Dramatische Gegensätzlichkeiten | 93 | ||
| IV Macht des Unbewussten contra staatstragende Gewalt: Marquise von O… und Prinz von Homburg | 93 | ||
| V Mythische Gewalten – Naturgewalten – Macht der Triebe: Die Familie Schroffenstein, Das Erdbeben in Chili und Der Findling | 114 | ||
| VI Tragische Gewalt – Poetische Grazie: Penthesilea und Käthchen von Heilbronn | 129 | ||
| VII Willensmacht – Machtwille: Die Herrmannsschlacht und Robert Guiskard | 143 | ||
| Dritter Teil / Akt: Komisch-tragische Auflösungen | 153 | ||
| VIII Erzählte Gewalten: Die Verlobung in St. Domingo – Der Zweikampf – Die Heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik | 153 | ||
| IX Macht der Zeichen – Fragile Deutungen: Der zerbrochne Krug – Amphitryon | 174 | ||
| X Gesetz und Gewaltmonopol in der Kunst: Der Fall des Michael Kohlhaas | 188 | ||
| XI Der verkörperte Gegensatz und Formen der Selbstdarstellung in Kleists Briefen | 196 | ||
| XII Subjektivität und ‚Gemeinschaft‘. Kleists Journalismus: Was gilt es in diesem Kriege? Satiren und andere Stilfragen | 207 | ||
| XIII Lyrik der Gegensätze: Gewalt und Grazie im Gedicht | 235 | ||
| Satyrspiel oder Das Gegensätzliche als Idylle: Der Schrecken im Bade | 251 | ||
| Bibliographie | 257 | ||
| Personenverzeichnis | 275 | ||
| Werkverzeichnis | 281 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish