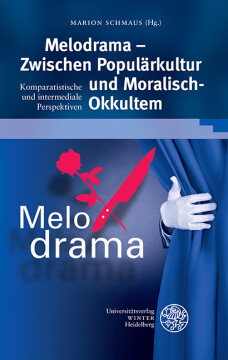
BUCH
Melodrama – Zwischen Populärkultur und Moralisch-Okkultem
Komparatistische und intermediale Perspektiven
Herausgeber: Schmaus, Marion
Beiträge zur neueren Literaturgeschichte [Dritte Folge], Bd. 310
2015
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Abgelöst von einem bestimmten Kunstgenre wird das Melodramatische als moderne kulturelle Praxis der Weltwahrnehmung gefasst, die auf höchste Emotionalität verweist und zur Ausdrucksform eines Moralisch-Okkulten wird. Als ein Modus der Bedeutungsproduktion, der mit Gefühlssteigerung, moralischer Polarisierung, antithetischer Figurenzeichnung, rhetorischer Überzeichnung, intertextuellem und intermedialem Spiel arbeitet, lässt sich das Melodramatische in Theater, Literatur, Musik und Film verfolgen. Den Versprechen, die in der Wortbedeutung des Kompositums aus Melos (Lied) und Drama (Handlung) liegen, dem ästhetischen einer Gleichberechtigung von Körpersprache, Musik und Dichtung sowie dem demokratischen einer Lesbarkeit der Welt und der menschlichen Existenz für alle, gehen die Beiträge dieses Bandes im interdisziplinären Dialog zwischen Germanistik, Anglistik/Amerikanistik, Romanistik, Theater-, Musik- und Filmwissenschaft nach.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | V | ||
| MARION SCHMAUS Melodrama: Zwischen Populärkultur und Moralisch-Okkultem. Einleitung | 1 | ||
| SABINE HENZE-DÖHRING Das Melodram im 18. Jahrhundert | 19 | ||
| ULRIKE EISENHUT Rousseaus „lyrische Szene“ Pygmalion (1762). Modellfall eines Melodramas | 35 | ||
| TINA HARTMANN Von der Sprache des Herzens zum Gesamtkunstwerk. Transformationen eines literarisch-musikalischen Idealtypus’ am Beispiel von Goethes Proserpina | 55 | ||
| MARION SCHMAUS Konstitution und Kritik melodramatischer Imagination. Rousseaus Pygmalion und Goethes Proserpina | 77 | ||
| FLORIAN GASSNER Politische Aspekte des Melodramas bei August von Kotzebue | 93 | ||
| GABY PAILER Melodramatik der Mesalliance. Zur Reprise von Walter Scotts Ivanhoe in Fanny Lewalds Jenny nebst einem Ausblick auf den Hollywoodfilm der 50er Jahre | 115 | ||
| CHRISTIANE PLANK-BALDAUF Zeit- und Handlungsbegriff in der melodramatischen Szene in der Oper des 19. Jahrhunderts | 147 | ||
| MATHIAS MAYER Die Ausnahme von der Ausnahme? Zur melodramatischen Opernszene im 19. und 20. Jahrhundert | 163 | ||
| ERIK REDLING Spectacular Drama: The Black Crook, Blackface Minstrelsy, and American Show Business in the 19th Century | 179 | ||
| MATTHIAS NÖTHER Der letzte Hauch von Ross und Melodram. Das Wechselspiel von sprecherischem Pathos und Musik im Melodram vor 1914 | 195 | ||
| VOLKER MERGENTHALER Wie Klabunds Totengräber ‚Stimmung‘ macht | 207 | ||
| CLAUDIA NITSCHKE Konzepte von Kriminalität und Melodrama: Fritz Langs M – Eine Stadt sucht einen Mörder | 223 | ||
| SIGRID NIEBERLE Gone with the Wind und deutschsprachige Intertexte. Melodramatische Imaginationen von Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg | 245 | ||
| FRANZ KÖRNDLE Melos im Film-Drama: Hitchcocks The Man Who Knew Too Much und seine Musik | 265 | ||
| JULIA STRAUB Bad Timing and Bad Tidings: Discontinuities in Melodrama | 283 | ||
| JÖRG METELMANN Im Korrekturmodus. Zum Melodram als Epochen-Imagination, Subjekt-Code und Medien-Hybrid | 301 | ||
| Beiträgerinnen und Beiträger | 329 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish