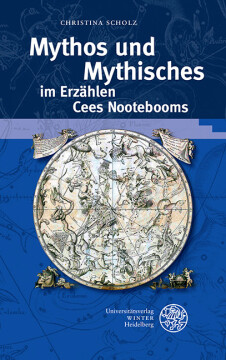
BUCH
Mythos und Mythisches im Erzählen Cees Nootebooms
Beiträge zur neueren Literaturgeschichte [Dritte Folge], Bd. 344
2016
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Cees Nooteboom entfaltet in ‚Der Umweg nach Santiago‘, ‚Die folgende Geschichte‘, ‚Allerseelen‘ und ‚Paradies verloren‘ ein mythisch reflektiertes Erzählen, das Themen, Motive und Stoffe der griechischen, römischen, biblischen und australischen Mythologie aufnimmt und variiert. Die Studie geht den Formen des Mythos und des Mythischen in Nootebooms Erzählen nach und arbeitet dessen mythische Strukturen heraus: Sie zeigen sich in Erzähl- und Erinnerungsproblematiken, die an menschlichen und geschichtlichen Verlust- und Brucherfahrungen entstehen. In der Auseinandersetzung damit entwickelt Nooteboom durch die Verknüpfung eines modern-linearen und eines mythisch-geschlossenen Erzählens eine erzählerische Spannung. Die daraus entstehende Doppelbödigkeit stellt die Untersuchung als konstitutiv für Nootebooms Erzählweise heraus.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | C | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Danksagung | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| 1 Einleitung | 13 | ||
| 2 Mythos und Mythisches in der Literatur der Gegenwart | 31 | ||
| 2.1 Bedeutsamkeit | 52 | ||
| 2.2 Mythisches Denken | 61 | ||
| 2.3 Ästhetik des Formalmythischen | 66 | ||
| 3 Mythos und Mythisches im Erzählwerk Cees Nootebooms | 75 | ||
| 3.1 ‚Mythen sind Vorbilder | 80 | ||
| 3.2 Doppelbödigkeit des Erzählens | 91 | ||
| 3.3 Erzählen als Vermittlung | 98 | ||
| 4 Werkanalysen | 109 | ||
| 4.1 ‚jeder Name ein Lockruf und eine Erinnerung’: "Der Umweg nach Santiago" | 109 | ||
| 4.1.1 ‚Welt der Wahlmöglichkeiten und Entscheidungen’: Umweg als narrative Technik | 111 | ||
| 4.1.2 ‚mnemotechnische Tradition’: Erinnerung und Raum | 115 | ||
| 4.2 Mythische Geschlossenheit des Erzählens: "Die folgende Geschichte" | 128 | ||
| 4.2.1 Doppelte Erzählstruktur | 130 | ||
| 4.2.1.1 Mythologisierungen der Figuren | 135 | ||
| 4.2.1.2 ‚Wir sind Nachkömmlinge’: Hybris, Schuld und Strafe als Erzählmotive | 139 | ||
| 4.2.2 Topographien des Erinnerns und Vergessens | 146 | ||
| 4.2.3 Erzählen als Ordnungsversuch | 155 | ||
| 4.2.3.1 Das Erzählen vom Tode her als die Entwicklung des Erzählers | 164 | ||
| 4.2.3.2 Erzählen als Sorge um sich | 177 | ||
| 4.2.4 Wandlungsmodelle: Thetis, Phaethon, Phaidon | 188 | ||
| 4.2.5 Fazit: "Die folgende Geschichte" als mythische Erzählung | 200 | ||
| 4.3 Mythisches und das Erzählen von Mythen in "Allerseelen" | 203 | ||
| 4.3.1 Odysseus: ‚eine alte Geschichte’ | 206 | ||
| 4.3.2 Der Orpheus-Eurydike-Mythos als Erinnerungsmodell | 228 | ||
| 4.3.3 Von Schwellenräumen und Raumschwellen | 234 | ||
| 4.3.3.1 Hadesfahrten: Topographien der Unterwelt | 244 | ||
| 4.3.3.2 Schatten: Fremdheit und die Wiederkehr der Toten | 251 | ||
| 4.3.4 ‚Welt der Erscheinungen | 257 | ||
| 4.3.4.1 Augenblickserfahrung als Epiphanie | 257 | ||
| 4.3.4.2 ‚Namen geben’ | 262 | ||
| 4.3.5 "Berlin 1989|2009" – "die Berliner Notizen I" und "III" | 266 | ||
| 4.3.6 ‚die Weltgeschichte durchkauen’: Erzählen als Geschichtsbewusstsein | 277 | ||
| 4.3.7 Die Instanz des Chores | 287 | ||
| 4.3.8 ‚mehr mit Lebenden als mit Toten zu tun’: Tod und Gedenken | 303 | ||
| 4.3.8.1 Auferstehung | 303 | ||
| 4.3.8.2 "Allerseelen" | 308 | ||
| 4.3.9 Fazit: Mythos und Erzählen in "Allerseelen" | 312 | ||
| 4.4 Mythos, Erzählen und Literatur in "Paradies verloren" | 316 | ||
| 4.4.1 ‚die Welt meine Wüste machen’: mythologische und biblische Motive | 319 | ||
| 4.4.2 Traumzeit und Traumpfade: Erzählen, Zeit und Raum | 330 | ||
| 4.4.3 Die Medialität der Engel | 333 | ||
| 4.4.4 Der epische Rhapsode und seine Muse | 338 | ||
| 5 Resümee | 347 | ||
| 6 Literaturverzeichnis | 363 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish