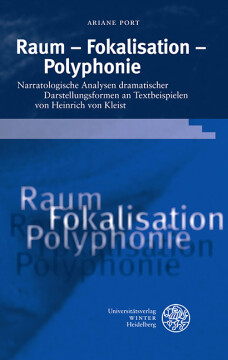
BUCH
Raum – Fokalisation – Polyphonie
Narratologische Analysen dramatischer Darstellungsformen an Textbeispielen von Heinrich von Kleist
Beiträge zur neueren Literaturgeschichte [Dritte Folge], Bd. 367
2018
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Seit Jahrhunderten beschäftigen sich Gelehrte mit den Darstellungsformen literarischer Texte. Sie überlegen, wie der Modus des Dramatischen beziehungsweise des Erzählenden zu beschreiben und zu benennen ist. Die Studie knüpft an diese Diskussion an, indem sie dramatische Texte vor diesem Hintergrund genauer untersucht. Gegenstand der Forschungsarbeit ist die Frage, was einen Text als einen dramatischen Text auszeichnet: Welche Merkmale sind grundlegend der dramatischen Darstellungsform zuzuordnen? Und wie kann man sie konziser von narrativen Merkmalen unterscheiden? Exemplarisch wird dies anhand von Dramen von Heinrich von Kleist diskutiert und mit Hilfe strukturaler Analysemethoden herausgearbeitet. Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Textanalysen wird mit Fokus auf die Kategorien „Raum“, „Fokalisation“ und „Stimme“ ein Beschreibungsmodell für dramatische Texte entworfen, das deren Darstellungsform strukturell präziser fassen und benennen kann.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | Cover | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhalt | 5 | ||
| Danksagung | 9 | ||
| 1 Einleitung | 11 | ||
| 1.1 Zielsetzung der Arbeit | 15 | ||
| 1.2 Methodische Vorüberlegungen | 17 | ||
| 1.3 Zum Textkorpus | 26 | ||
| 2 Positionierung des Themas innerhalb der Forschungsliteratur | 31 | ||
| 2.1 Zur transgenerischen Forschung | 32 | ||
| 2.2 Raumkonzepte in aktuellen Forschungsarbeiten | 37 | ||
| 2.3 Stimme und Dialogizität | 44 | ||
| 3 Bewegung im Raum – Bewegung im Text: Theoretische Grundlagen | 49 | ||
| 3.1 Narratologische Modelle | 49 | ||
| 3.1.1 Verortung und Fokalisation: Genettes Kategorien Modus und Stimme | 53 | ||
| 3.1.2 Polyphonie und Narratologie | 61 | ||
| 3.1.3 Zur Konstruktion von Stimme(n) im Text: Beispielanalyse „Der Findling“ | 67 | ||
| 3.2 Text und Raum | 81 | ||
| 3.2.1 Dynamisierung des Raumes: Beispielanalyse Das Erdbeben in Chili | 82 | ||
| 3.2.2 Zwischenfazit | 100 | ||
| 3.2.3 Zwischen Statik und Dynamik: Raum in dramatischen/theatralen Texten | 103 | ||
| 4 Analysen | 109 | ||
| 4.1 Verortung im Bühnenraum: Dynamische Raumstrukturen in „Amphitryon“ und „Prinz Friedrich von Homburg“ | 109 | ||
| 4.1.1 Seitenwechsel und doppelte Verortung: Zur dynamischen Strukturierung des Bühnenraumes in „Amphitryon“ | 110 | ||
| 4.1.1.1 Verortung in erzählten Räumen | 113 | ||
| 4.1.1.2 Verortung im Bühnenraum | 119 | ||
| 4.1.2 „Wo ist der Prinz von Homburg?“ – Parallele Räume, parallele Handlungen: Zur Standortbestimmung in „Prinz Friedrich von Homburg“ | 129 | ||
| 4.1.2.1 Interne und externe Fokalisation in der Anfangssequenz | 135 | ||
| 4.1.2.2 Parallelisierung von Räumen | 139 | ||
| 4.1.2.3 Bewegungsrichtungen und Verortungen im Geschehen | 144 | ||
| 4.1.3 Zwischenfazit | 150 | ||
| 4.2 Verortung in imaginären Räumen: Zur Konstruktion von Texträumen in „Der zerbrochne Krug“ und „Das Käthchen von Heilbronn oder die Feuerprobe“ | 153 | ||
| 4.2.1 Hybride Orte: Formen der Transpositionierung in „Der zerbrochne Krug“ | 154 | ||
| 4.2.1.1 Bild und Text: Der Kupferstich in der „Vorrede“ | 156 | ||
| 4.2.1.2 Positionierungen im Text: Die Figurenrepliken | 159 | ||
| 4.2.1.3 Konstruktionsverfahren im Text: Positionierung an hybriden Orten | 166 | ||
| 4.2.2 „Jung’! Wer hat dir das gesagt? So sprich.“ – Rede- und Stimmenvielfalt in „Das Käthchen von Heilbronn“ oder die Frage nach der Basis einer Erzählung | 172 | ||
| 4.2.2.1 Stimmenvielfalt und Orientierung vor dem Femegericht | 181 | ||
| 4.2.2.2 drinnen/draußen: Standpunkte im Geschehen | 188 | ||
| 4.2.2.3 Positionierung in unsichtbaren Räumen | 198 | ||
| 4.2.3 Zwischenfazit | 210 | ||
| 4.3 Verortung und Perspektive: Fokale Instanzen in „Die Familie Schroffenstein“ und „Penthesilea“ | 213 | ||
| 4.3.1 „Denn nicht wirst Du verlangen, / Daß ich mit Deinen Augen sehen soll.“ – Zur Struktur monologischer Dialoge in „Die Familie Schroffenstein“ | 213 | ||
| 4.3.1.1 Monologische Dialoge | 219 | ||
| 4.3.1.2 „[…] ich war / Im eigentlichsten Sinn nicht gegenwärtig.“ Aussagen im Text | 223 | ||
| 4.3.1.3 Von monologisch zu dialogisch – Dynamiken im Text | 232 | ||
| 4.3.2 „Das ganze Amazonenheer zerstreut“ – Räumliche (Des-)Orientierung in „Penthesilea“ | 243 | ||
| 4.3.2.1 „Im blut’gen Feld der Schlacht“: Standorte im Geschehen | 247 | ||
| 4.3.2.2 „Auf uns den Lauf!“: Bewegung und Stillstand im Geschehen | 259 | ||
| 4.3.3 Zwischenfazit | 267 | ||
| 5 Modell zur Beschreibung von polyphonen Strukturen in Dramen | 271 | ||
| 5.1 Zusammenfassung der geleisteten Dramentextanalysen | 272 | ||
| 5.1.1 Die Art und Weise der figuralen Verortung | 273 | ||
| 5.1.2 Die Bündelung sprachlich formulierter Blickwinkel auf das Geschehen (Polyphonie) | 274 | ||
| 5.1.3 Die Relation zwischen dem Handlungsraum der Figuren und ihrem Wahrnehmungsraum (Fokalisation) | 275 | ||
| 5.2 Strukturelle Grundlagen zur Erstellung des Beschreibungsmodells | 277 | ||
| 5.3 Das Beschreibungsmodell | 278 | ||
| 5.4 Abschließende Textbeispiele | 284 | ||
| 6 Schlussbetrachtung | 289 | ||
| Verwendete Literatur, Verzeichnisse | 291 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish