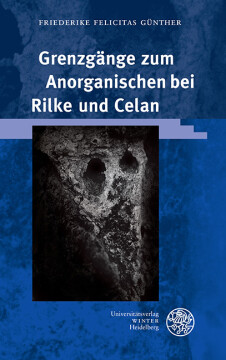
BUCH
Grenzgänge zum Anorganischen bei Rilke und Celan
Beiträge zur neueren Literaturgeschichte [Dritte Folge], Bd. 372
2018
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Paul Celans Werk grenze an eine „Sprache des Leblosen“ (Th. W. Adorno), Rainer Maria Rilkes Lyrik feiere das Leben noch im Tod: Die literaturwissenschaftliche Forschung sieht bei den beiden Autoren wenig Gemeinsamkeiten. Die vorliegende Studie zeigt demgegenüber in textnahen Analysen exemplarischer Gedichte, dass sich Rilke und Celan in der Auseinandersetzung mit dem „Menschenfremdesten“ (H. Böhme) – dem Anorganischen – als einem Konvergenzpunkt ihrer Lyrik in größter Nähe zueinander bewegen. Rilkes Gedichte beschwören das Numinose nicht nur in der lebenden Natur, sondern auch im Felsgestein, das für das Gott zugewandte Ich zur existenziellen Bedrohung wird. Celans Gedichte wiederum vergegenwärtigen eine umfassende Totenlandschaft, der sich das sprechende Ich immer weiter annähert, reduziert auf seine kreatürliche Existenz. Beider Dichtung ist verbunden in der Frage: Wie ist der grundierenden Übermacht des Leblosen in menschlicher Sprache überhaupt zu begegnen?
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | Cover | ||
| Titel | III | ||
| Impressum | IV | ||
| Inhaltsverzeichnis | V | ||
| I Einleitung | 1 | ||
| I.1 „Aufstoßen aufs Anorganische“ bei Rilke | 8 | ||
| I.2 Das Gedicht als steinernes Gegenwort bei Celan | 21 | ||
| I.3 Kunstmetaphysik versus Anthropologie des Steinernen | 36 | ||
| I.4 Das Tote als Menschenwerk | 42 | ||
| II Rilke: Anthropologie zum Tode hin | 51 | ||
| II.1 Grenzgänge zum Anorganischen | 67 | ||
| II.1.1 „Vielleicht, daß ich durch schwere Berge gehe“ (1903). Gott als Stein | 67 | ||
| II.1.2 „Der Gefangene“ (1906). Anpassung an die Zeit des Anorganischen | 87 | ||
| II.2 Grenzübertritte zum Anorganischen I: Kunst und Kosmos | 105 | ||
| II.2.1 „Der Einsame“ (1907). Erhabenes Kunst-Ding ohne Grauen | 105 | ||
| II.2.2 „Der Käferstein“ (1908). Verlust des Organischen im Anorganischen | 133 | ||
| II.3 Grenzübertritte zum Anorganischen II: Stein und Stern | 153 | ||
| II.3.1 „Heimkehr: wohin?“ (1914). Ein Herz aus Stein | 153 | ||
| II.3.2 „Einmal noch“ (1914). Strömendes Antlitz | 181 | ||
| II.4 Das Tote als Menschenwerk | 203 | ||
| II.4.1 „Cimetière à Flaach“ (1921). Steinerne Absolutheit des Todes | 203 | ||
| III Celan: Anthropologie vom Tode her | 217 | ||
| III.1 Bruch mit der Tradition poetischer Todesaffinität | 225 | ||
| III.1.1 „Am letzten Tor“ (1948). Abschied vom Herbst | 225 | ||
| III.1.2 „Der Stein aus dem Meer“ (1950). Abschied vom Herzen | 249 | ||
| III.2 Spielräume poetischen Sprechens in einer Totenlandschaft | 269 | ||
| III.2.1 „Flügelnacht“ (1954). Anorganische statt organischer Sprache | 269 | ||
| III.2.2 „Die Halde“ (1954). Regung des Menschlichen im Leblosen | 291 | ||
| III.2.3 „Schneebett“ (1957). Todesnähe als Nähe zum Toten | 317 | ||
| III.3 Hoffnungsschimmer? Helligkeit und Singbarkeit | 351 | ||
| III.3.1 „Die hellen Steine“ (1961). Unerträgliche Leichtigkeit des Steins | 351 | ||
| III.3.2 „Singbarer Rest“ (1964). Tödliche Schrift und Sprechrest | 383 | ||
| III.4 Die Tödlichkeit des Toten | 405 | ||
| III.4.1 „Wer schlug sich zu dir?“ (1967). Leere der Höhe | 405 | ||
| III.4.2 „Du gleissende“ (1969). Tödlichkeit und Sterblichkeit des Gedichts | 415 | ||
| IV Schlusswort | 429 | ||
| V Abkürzungen | 435 | ||
| VI Literaturverzeichnis | 437 | ||
| VII Namenregister | 455 | ||
| Dank | 461 | ||
| Backcover | 462 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish