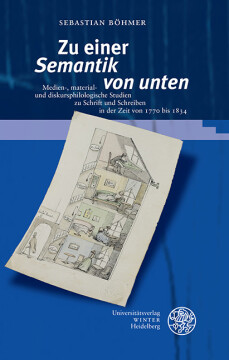
BUCH
Zu einer ‚Semantik von unten‘
Medien-, material- und diskursphilologische Studien zu Schrift und Schreiben in der Zeit von 1770 bis 1834
Beiträge zur neueren Literaturgeschichte [Dritte Folge], Bd. 381
2018
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Ab 1770 gerät das im deutschsprachigen Raum etablierte Schriftkonzept der Aufklärung zunehmend unter Druck. In ihm herrschte die mechanistische Vorstellung einer vollständigen Übertragung genau eines Sinns (Signifikat) durch einen ‚reinen‘ Kanal (Signifikant) vor. Es erwies sich jedoch als zunehmend untauglich, um Komplexität zu bewältigen. Die Studie untersucht neue Möglichkeiten schriftlicher Abbildung, die sich um 1800 zeitgleich entwickelten: Einige Autoren hielten am Übertragungsprinzip fest, förderten zu diesem Zweck aber technische Innovationen. Andere thematisierten die Erosion des alten Konzepts und fanden verschiedene Wege, produktiv mit ihr umzugehen. Zudem differenzierte sich ein neues Zeichenmodell aus, das durch den Rekurs auf die materiellen, raumzeitlichen sowie personalen Bedingungen der Schrift eine freie Sinn-Generierung ermöglichte: die ‚Semantik von unten‘.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | C | ||
| Titel | III | ||
| Impressum | IV | ||
| Inhaltsverzeichnis | V | ||
| 1 Einleitung | 1 | ||
| 1.1 Programm und Stand der Forschung | 1 | ||
| 1.2 Aufbau der Arbeit | 5 | ||
| 2 Idealismus der Zeichen. Die ‚Semantik von oben‘ | 13 | ||
| 2.1 Sinn und Schrift im Zeitalter der Aufklärung | 13 | ||
| 2.2 Denken – Sprechen – Schreiben im 18. Jahrhundert | 16 | ||
| 2.3 ‚Wahrheit‘ und Schrift | 22 | ||
| 2.4 Die Mechanik der Schrift | 29 | ||
| 3 Wege I: Exempel der Effizienz | 35 | ||
| 3.1 Exempel der Effizienz 1: Notate. Knigge bewältigt Komplexität | 35 | ||
| 3.1.1 Theorie | 35 | ||
| 3.1.2 Praxis | 36 | ||
| 3.2 Exempel der Effizienz 2: Stenographie. Mosengeil entwirft neue Zeichen | 39 | ||
| 3.2.1 Theorie | 39 | ||
| 3.2.2 Praxis | 43 | ||
| 3.3 Exempel der Effizienz 3: Schreibgerät. Nicolai verwendet einen Füller | 45 | ||
| 3.3.1 Theorie | 45 | ||
| 3.3.2 Praxis | 48 | ||
| 3.4 Exempel der Effizienz 4: Drucklettern. Unger reformiert die Typographie | 52 | ||
| 3.4.1 Theorie | 52 | ||
| 3.4.2 Praxis | 55 | ||
| 3.5 Exempel der Effizienz 5: Herrenschrift und Schreibefaulheit bei Goethe (Diktieren | 64 | ||
| 3.5.1 Statt einer Theorie: Goethe in seinem Arbeitszimmer, seinem Schreiber John diktierend. Eine Bildanalyse | 64 | ||
| 3.5.2 Praxis: Fremde Hände. Sprechen als bequemes Schreiben | 76 | ||
| 4 Wege II: Schrift- und Schreibkonzepte diesseits der ‚Semantik von oben‘ | 85 | ||
| 4.1 Umwege, Erweiterungen, Preisgaben. Ein kurzer Überblick | 85 | ||
| 4.2 „Drang und Ekel zum Schreiben“. Luise von Göchhausens scheiternde Abbildung von Empfindungen in Schrift | 87 | ||
| 4.2.1 Die neue ‚Rede‘ vom ‚Herzen | 87 | ||
| 4.2.2 Das neue Schreiben vom und mit dem ‚Herzen‘ | 90 | ||
| 4.2.3 Die schreckliche Unmöglichkeit von schriftlicher Übertragung komplexer Gefühle | 97 | ||
| 4.2.4 Den Ekel überwinden: Göchhausens schriftliche Halluzination eines „Abends hier beym Kamin“ | 105 | ||
| 4.3 Sein Gedicht von Ihrer Hand. Charlotte von Stein soll Goethe schreiben | 107 | ||
| 4.3.1 Sinn und Form von Goethes Brief an Charlotte von Stein vom 16. April 1776 | 108 | ||
| 4.3.2 Goethe bittet um Abschrift seines Gedichts | 116 | ||
| 4.3.3 Körperzeichen | 118 | ||
| 4.3.4 Verkehrte Schreibe-Welt: Der Dichter will die Frau schreiben machen | 123 | ||
| 4.4 „auf eine magische Weise“. Wie und weshalb Goethe Autographe sammelte | 125 | ||
| 4.4.1 Einleitung | 125 | ||
| 4.4.2 Aufbau der Autographensammlung | 132 | ||
| 4.4.3 Die Magie der Schrift | 138 | ||
| 4.5.1 Laute und Lettern | 149 | ||
| 4.5.2 Reine Signifikanten | 151 | ||
| 4.5.3 Die Präsenz der Schrift | 159 | ||
| 4.5 Druckletterskulpturen. Wieland entdeckt den ‚reinen Signifikanten‘ | 148 | ||
| 4.6 Am Nullpunkt der ‚Semantik‘. Goethes orientalische Schreibübungen als ‚transzendentale Mimesis‘ | 162 | ||
| 4.6.1 Versammlung, nicht Verschmelzung. Goethe und der Orient | 163 | ||
| 4.6.2 „Soll dich Chisers Quell verjüngen“. Der Urton der Dichtung | 167 | ||
| 4.6.3 Bedeutung und Funktion des Schreibakts: Die ‚transzendentale Mimesis‘ | 171 | ||
| 5 Wege III: Die Entkopplung des Sinns von der Schrift. Die ‚Semantik von unten‘ | 181 | ||
| 5.1 Das Schreiben der Schrift. Zur Genese der Pluralisierung von Sinn | 181 | ||
| 5.1.1 Vom Abschreibesystem zum Aufschreibesystem: Herder und Lichtenberg | 182 | ||
| 5.1.2 Schreibarbeit: Wieland, Goethe und einige ihrer Zeitgenossen | 190 | ||
| 5.1.3 Von der Vollkommenheit zur Vervollkommnung | 197 | ||
| 5.1.4 Die Erfindung der ‚Semantik von unten‘ | 204 | ||
| 5.2 Körper, Schreibmöbel und Dichtung. Der ‚Schreiber zweiter Ordnung‘ | 211 | ||
| 5.2.1 Der Auftakt: Wieland beschreibt einen schreibenden Körper | 211 | ||
| 5.2.2 Schreibmöbel | 218 | ||
| 5.2.3 Die ‚Semantik von unten‘ als Dichtung | 226 | ||
| 5.3 Gefährdete Aufklärung. Licht und Schreiben in Georg Forsters ‚Ansichten vom Niederrhein‘ | 231 | ||
| 5.3.1 Ein ‚Schreiber zweiter Ordnung‘ in einem Reisebericht der Aufklärung | 232 | ||
| 5.3.2 Die Aufklärung im Wirtshaus | 235 | ||
| 5.3.3 Funkensprühendes Licht. Die Aufklärung unter den Bedingungen der ‚Semantik von unten‘ | 238 | ||
| 5.4 Dichter diktieren nicht (Diktieren | 243 | ||
| 5.4.1 Goethes Apostel | 244 | ||
| 5.4.2 Dichtung und Botschaft | 250 | ||
| 5.5 ‚Maria Stuart‘ als Drama der Schrift | 258 | ||
| 5.5.1 Unterschreiben auf der Bühne | 259 | ||
| 5.5.2 Die Schreibszene (IV,10) | 266 | ||
| 5.5.3 Schriftpolitik. Semiotik als Problem der Verantwortung | 272 | ||
| 5.6 Des Volkes Schrift. Die Überlieferungs- und Dichtungstheorie des Schreibens in Tiecks „Mährchen-Novelle“ ‚Das alte Buch UND Die Reise ins Blaue hinein‘ | 275 | ||
| 5.6.1 Das Volk singt, es schreibt nicht | 275 | ||
| 5.6.2 Gesammelte Lieder | 278 | ||
| 5.6.3 „neu abgeschrieben und bearbeitet“. Tiecks ‚altes Buch‘ als Dichtungstheorie der überlieferten Schrift | 284 | ||
| 6 Epilog | 301 | ||
| Dank | 305 | ||
| Literatur- und Siglenverzeichnis | 307 | ||
| Abbildungsverzeichnis | 337 | ||
| Backcover | 339 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish