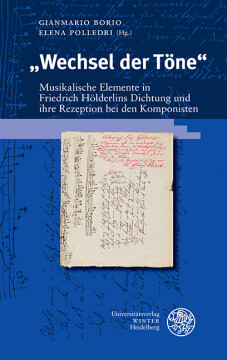
BUCH
„Wechsel der Töne“
Musikalische Elemente in Friedrich Hölderlins Dichtung und ihre Rezeption bei den Komponisten
Herausgeber: Borio, Gianmario | Polledri, Elena
Beiträge zur neueren Literaturgeschichte [Dritte Folge], Bd. 390
2019
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Friedrich Hölderlin gründete seine Poetik vom „Wechsel der Töne“ auf musikalischen Gesetzen und entnahm der Musik seine Metaphern, von der Hymne an die Göttin der Harmonie zur „Auflösung der Dissonanzen“ Hyperions, von den „reinen Melodien“ und dem „Saitenspiel“ zum „blinden Sänger“, von den „Nachtgesängen“ zu den „vaterländischen Gesängen“. Die außerordentliche Faszination, die sein Werk im 20. Jahrhundert auf Komponisten unterschiedlicher geographischer Herkunft und ästhetischer Orientierung ausübte, führte zu einer Flut von Vertonungen seiner Gedichte, zu Dramatisierungen seiner Texte, zu Instrumentalwerken und vielen anderen Formen der musikalischen Kreativität. Unter dieser Voraussetzung versucht der vorliegende Band – Ergebnis eines mehrjährigen Austauschs unter Germanisten, Musikwissenschaftlern und Philosophen – einerseits die musikalischen Grundlagen von Hölderlins Werk, andererseits den fruchtbaren Dialog der Komponisten mit dem Dichter näher zu bestimmen und dadurch Formen des interdisziplinären Dialogs zu praktizieren.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Vorwort und Danksagung | 7 | ||
| Gianmario Borio, Elena Polledri, Friedrich Hölderlin: Dichtung und Musik. Eine Einführung aus doppelter Perspektive | 11 | ||
| Ulrich Gaier, Musik, Metrik, Energie: Klopstock, Hamann, Herder, Heinse, Hölderlin | 25 | ||
| Luigi Reitani, Friedrich Hölderlin: ein musikalischer Dichter | 41 | ||
| Martin Zenck, Komponieren mit und ohne Hölderlin. Stadien der Hölderlin-Rezeption in der Neuen Musik | 53 | ||
| Dieter Burdorf, „bald sind [wir] aber Gesang“. Zu einem Grundmotiv bei Hölderlin | 77 | ||
| Boris Previšić, Vielstimmigkeit und Verzeitlichung im 18. Jahrhundert sowie Hölderlins musikalische Rückbindung in den Stromgedichten um 1800 | 95 | ||
| Elena Polledri, Hölderlin und die Ästhetik der Dissonanz | 109 | ||
| Francisco Rocca, Hölderlin (frammento) von Giacomo Manzoni: Aufbau des lyrischen Textes und kompositorische Techniken | 139 | ||
| Andreas Meyer, Spätzeit? Hölderlin und die Musikgeschichte der 1980er Jahre | 171 | ||
| Gianmario Borio, Zur parallelen Rezeption von Hölderlin und Schumann in der kompositorischen Landschaft nach 1968 | 195 | ||
| Antonio Rostagno, Ende vom Lied: Hölderlins obscuritas und Fragment bei Kurtág und Rihm | 219 | ||
| Manfred Frank, Über die Erzeugung von Bedeutung aus der Stille. Luigi Nonos Begegnung mit Hölderlin | 255 | ||
| Martin Vöhler, Hans Zenders Auseinandersetzung mit Hölderlins Patmos | 277 | ||
| Autorinnen und Autoren | 293 | ||
| Namenregister | 299 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish