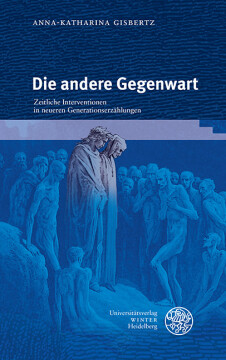
BUCH
Die andere Gegenwart
Zeitliche Interventionen in neueren Generationserzählungen
Beiträge zur neueren Literaturgeschichte [Dritte Folge], Bd. 391
2019
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Generationserzählungen stellen die Geschichte im Fokus von Familiengeschichten dar, entwerfen Gegenwartsanalysen und Zukunftsvisionen. Um die Irritationen und Leerstellen im gegenwärtigen kulturellen Verhältnis zwischen den Generationen narrativ zu erfassen, kommt die Vergangenheit als fragiles Gebilde – einschließlich des Verschwiegenen und Vergessenen – zur Sprache. Die vorliegende Studie erkundet die Reflexion auf diese fragile Zeitform und ihre innovativen Erzählformate: Nach einem historischen Einblick in die Gattungstradition rücken die inkommensurablen Aspekte des Vergangenen im Modus der Nachträglichkeit, des Traumas, der Asynchronisierung und der Ausnahmezeit der Feier in den Blick. Damit eröffnen neuere Generationserzählungen die Möglichkeit zur Erkundung einer ‚anderen‘, dem Eindruck der Beschleunigung und fortlaufenden Wandlung gegenüber beharrlichen Gegenwart und ihrer literarischen Repräsentationen.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhalt | 5 | ||
| Einleitung | 9 | ||
| Generationserzählungen als Zeiterzählungen | 12 | ||
| Zum Forschungsstand der Generationserzählungen | 17 | ||
| Die „andere Gegenwart“ | 25 | ||
| Abgrenzung von der Generationsforschung | 31 | ||
| Vorgehen in der Arbeit | 34 | ||
| Kapitel 1: Geschichte und Bedeutung der Generationserzählung | 37 | ||
| Aufstiegs- und Verfallsgeschichten | 38 | ||
| Generationenromane von Gustav Freytag und Adalbert Stifter | 43 | ||
| Von der Idealisierung zum sozialkritischen Roman: Émile Zolas „Les Rougon-Macquart“ | 49 | ||
| Populäre Generationserzählungen im 20. Jahrhundert | 52 | ||
| Posthistoire? | 57 | ||
| Kapitel 2: Erzählen und Wiederholen | 59 | ||
| Traumafiktionen | 59 | ||
| Chaotische Muster in W.G. Sebalds „Austerlitz“ (2001) | 62 | ||
| Peter Handkes Zwischenreich: „Die Wiederholung“ (1986 | 68 | ||
| Das Reich der Wiederkehr | 70 | ||
| Der Erzähler als ‚Wegmacher’ | 73 | ||
| Umschrift des Vergangenen | 77 | ||
| Ästhetik einer Zwischenzeitlichkeit | 82 | ||
| Fazit | 84 | ||
| Kapitel 3: Ungegenwärtiges erzählen | 87 | ||
| „Was ich nicht sehen kann, muß ich erfinden“. Marcel Beyers „Spione“ (2000) | 88 | ||
| Der Text als Haut | 94 | ||
| Jenny Erpenbecks Auslöschungsprosa „Aller Tage Abend“ (2012) | 96 | ||
| Serielle Katastrophen | 99 | ||
| Zauderrhythmus des Erzählens | 102 | ||
| Der Mauerfall als Trauma | 105 | ||
| In Dantes Unterwelt | 107 | ||
| Schreiben und Tanzen. Nino Haratischwilis „Das achte Leben (für Brilka)“ (2014) | 113 | ||
| Gespenster | 117 | ||
| Riskantes Schreiben | 121 | ||
| Gegenstrategie: Irene Disches „Großmama packt aus“ (2006) | 122 | ||
| Fazit | 124 | ||
| Kapitel 4: Synchrones und asynchrones Erzählen | 127 | ||
| Ein Tagtraum in Arno Geigers „Es geht uns gut“ (2005) | 129 | ||
| Im „Wartesaal der Möglichkeiten“: Zukunftssemantiken in drei Generationen | 134 | ||
| Kontinuität und Kontingenz | 136 | ||
| Erzählen im Präsens | 140 | ||
| Vergeblichkeit in Eugen Ruges „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ (2011) | 143 | ||
| Fazit | 145 | ||
| Kapitel 5: Nachträgliches Erzählen: die literarische Biographie | 147 | ||
| Sigmund Freuds Konzept der Nachträglichkeit | 149 | ||
| Präsenzeffekte | 157 | ||
| Stephan Wackwitz‘ „Ein unsichtbares Land“ (2003) | 162 | ||
| Uwe Timms „Am Beispiel meines Bruders“ (2003) | 169 | ||
| Anne Webers (Ahnen. Ein Zeitreisetagebuch“ (2015) | 174 | ||
| Geschichten statt Schweigen | 177 | ||
| Fazit | 180 | ||
| Kapitel 6: Feste und Feiern: Prosa am Scheideweg | 185 | ||
| Scheiternde Familienfeiern | 185 | ||
| Der Alltag und das Fest | 188 | ||
| Das Fest und die Feier | 192 | ||
| Die Familienfeier als „contradictio in adiecto“ | 194 | ||
| Väter, Söhne – und Mütter: Ende des Patriarchats? | 196 | ||
| Uwe Tellkamps „Der Turm“ (2008) | 201 | ||
| Das totale Fest | 207 | ||
| John von Düffels „Houwelandt“ (2004) | 209 | ||
| Die Wiederkehr des Gleichen (noch einmal Ruge) | 214 | ||
| Fazit | 220 | ||
| Kapitel 7: Die „andere Gegenwart“ im kulturwissenschaftlichen Diskurs | 225 | ||
| Gegenwart als Beschleunigung | 228 | ||
| Breite Gegenwart | 231 | ||
| Nachleben, Nachhaltigkeit | 234 | ||
| Die nicht-erlebte Zeit | 236 | ||
| Schluss | 238 | ||
| Danksagung | 242 | ||
| Literaturverzeichnis | 243 | ||
| Rückumschlag | 271 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish