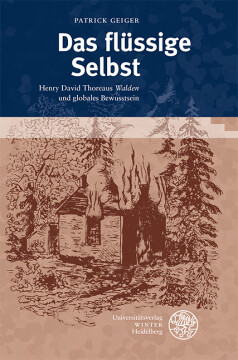
BUCH
Das flüssige Selbst
Henry David Thoreaus ‚Walden‘ und globales Bewusstsein
Beiträge zur Philosophie, Neue Folge
2021
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Thoreaus Wahrnehmung der sich im „restless, nervous, bustling, trivial nineteenth Century“ verdichtenden Globalisierungsdynamik zwingt ihn zu einer radikalen Revision des ‚westlich‘ geprägten Subjektdenkens. In ‚Walden‘ entwirft er ein „flüssiges Selbst“, das als Versuch verstanden werden kann, die Gegensätze zwischen der Ausdehnungserfahrung der Zeitgeschichte und dem Bewusstsein über die Zwänge der Erfahrungswelt zu integrieren: Während sich die Perspektive des erlebenden Ich ins Grenzenlose erweitert, präsentieren sich die konkreten Lebensumstände der Menschen als unausweichliche Beschränkungen. Diesem Sachverhalt begegnet Thoreau mit einer Re-Evaluierung der lebensweltlichen Verhältnisse unter Miteinbezug der neuen, globalisierten Parameter. Das „flüssige Selbst“ entspringt dieser Praxis zwischen Abgrenzung, Tradierung, Neubegründung und Kontingenz. Die vorliegende Studie erläutert kenntnisreich und stringent, wie ‚Walden‘ damit den Versuch darstellt, der stetig wachsenden erlebbaren Welt und ihren globalen Verbindungen mit angemessenen Modifikationen im Denken und Sprechen über das Selbst zu begegnen.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Danksagung | 5 | ||
| Inhalt | 7 | ||
| 1 Einleitung | 9 | ||
| 2 Das flüssige Selbst bei Henry David Thoreau | 25 | ||
| 2.1 Annäherung, Begründung, Angemessenheit | 27 | ||
| 2.2 Das flüssige Selbst denken als Praxis: Subjektivität und Lebensphilosophie | 36 | ||
| 2.2.1 Das fluide „Subjekt“ | 36 | ||
| 2.2.2 Das “fluide” Subjekt | 53 | ||
| 2.3 Fluidität als Mastertrope | 57 | ||
| 2.4 Warum das flüssige Selbst Globalisierung übersetzt und mitentwirft | 69 | ||
| 3 Die Rolle der Philosophie im Zeitalter der Globalisierung: Thoreau als Vorbild | 79 | ||
| 3.1 Stanley Cavells Thoreau: „The solid bottom of reading“ | 85 | ||
| 3.2 Thoreau und der deutsche Idealismus: Eine spezifische Bezugnahme mit offenem Ausgang | 112 | ||
| 3.3 Walden und Welt: Thoreau, Heidegger, Cavell | 127 | ||
| 3.3.1 Was die Welt sein, was „Welt“ sagen kann | 128 | ||
| 3.3.2 Die Welt Walden (Walden, „walled-in“) | 133 | ||
| 3.3.3 Uncanny cabin: Skeptisches Zuhausesein | 173 | ||
| 3.4 Thoreau mit Wittgenstein lesen: Weltanschauung, Aspekte sehen lernen, „Philosophie“ | 199 | ||
| 3.4.1 Seeing things anew: Alltag als Schauplatz der Beheimatung | 199 | ||
| 3.4.2 Lesen, Leben, Lernen: „uncommon schools“ | 215 | ||
| 3.4.3 Lebensphilosophie, Praxis, gelebte Vernunft: „moulting season“ | 250 | ||
| 3.4.4 Schwebe, Ich, Ekstase: Verzweiflung und flüssiges Selbst | 262 | ||
| 4 Thoreaus Ästhetik der Zurückhaltung: Das Politische in Walden | 277 | ||
| 5 Die Poetik der Fluidität: Mit Literatur das Leben ausmessen | 297 | ||
| 6 Globalisierung schreiben, Globalisierung lesen lehren | 329 | ||
| 7 Schlussbemerkung | 359 | ||
| 8 Literatur | 363 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish