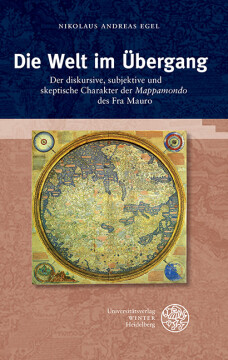
BUCH
Die Welt im Übergang
Der diskursive, subjektive und skeptische Charakter der ‚Mappamondo‘ des Fra Mauro
Beiträge zur Philosophie, Neue Folge
2014
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Die Arbeit zielt auf eine Lektüre der berühmten ‚Mappamondo‘ Fra Mauros (um 1450), die auf deren diskursiven Charakter abhebt und die Strategien und Kriterien der jeweiligen Autoritätsevaluation und der damit einhergehenden Weltbildgewinnung zu rekonstruieren versucht. Ohne kartographisch einem paradigmatischen Weltbild verpflichtet zu sein, katalogisiert Fra Mauro immer wieder eine Vielzahl alternativer Deutungsmöglichkeiten. Damit schafft der Kartograph einen diskursiven Kartenraum, der die neue Welt noch nicht festlegt. Zugleich wird der Übergang der kartographischen Erfassung der Welt in einem Moment beschrieben, in dem verschiedene Betrachtungsweisen und deren weltbildliche Hintergründe noch unentschieden von der Empirie in ihrem Geltungshorizont gleichberechtigt auftreten und undogmatisch dargestellt werden. Dass dahinter seitens Fra Mauros eine unausgesprochene philosophische Prämisse steht: Dies herauszuarbeiten ist das Anliegen der Arbeit, die insofern eine wirklich neue Dimension der Betrachtung auf die ‚Mappamondo‘ und ihre weltbildlichen Hintergründe eröffnet.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Vorwort | 9 | ||
| Teil I: Der Entstehungshintergrundder Mappamondo und dasgeistige Umfeld Fra Mauros | 31 | ||
| 1 Fra Mauro und Venedig | 33 | ||
| 1.1 Fra Mauros Mappamondo | 33 | ||
| 1.2 San Michele di Murano und der Kamaldulenserorden | 40 | ||
| Teil II: Facetten.Der Kontext der Mappamondo | 53 | ||
| 2 Aufriss der verschiedenen für die Mappamondo entscheidenden Traditionen der Kartographie | 55 | ||
| 3 Mittelalterliche Mappae mundi | 61 | ||
| 3.1 „Mappa mundi“: eine Begriffsbestimmung | 63 | ||
| 3.2 Das Mappa mundi-Genre im Umfeld der mittelalterlichen Enzyklopädistik | 66 | ||
| 3.3 Die Haltung der mittelalterlichen Enzyklopädisten gegenüber dem Kanon der Autoritäten | 73 | ||
| 3.4 Fra Mauros Haltung gegenüber den Autoritäten | 78 | ||
| 3.5 Exkurs: Die Herefordkarte | 80 | ||
| 3.5.1 Abmessung und Größenverhältnisse | 82 | ||
| 3.5.2 Die Einrahmung der Herefordkarte | 84 | ||
| 3.5.3 Geschichte und Heilszeit als strukturgebende Merkmale | 88 | ||
| 3.5.4 Die Autoritäten | 95 | ||
| 3.5.5 Zusammenfassung | 105 | ||
| 4 Die Kartographie des 14. und 15. Jahrhunderts | 107 | ||
| 4.1 Die Weltkarte des Pietro Vesconte von 1321 | 107 | ||
| 4.2 Widersprüche zwischen den antiken Autoritäten und den Modernen: Das Kaspische Meer auf der Weltkarte des Pietro Vesconte, bei Boccaccio und Pierre d’Ailly | 114 | ||
| 4.3 Die Portolankartographie | 120 | ||
| 4.3.1 Herstellung und Entstehungshintergrund der Portolankarten | 120 | ||
| 4.3.2 Der Einflfluss der Portolankarten auf die intellektuellen Kreise in Italien | 124 | ||
| 4.4 Die Geographia des Claudius Ptolemäus | 128 | ||
| 4.5 Die Asienreisen | 140 | ||
| 4.5.1 Niccolò de’ Contis Reiseroute | 141 | ||
| 4.5.2 „Hic sunt multa et infifinita mirabilia. Et incipit in hac prima Yndia quasi alter mundus“ – Reisen in den Orient im Mittelalter | 147 | ||
| 4.5.3 „Dort gibt es Gold in großer Menge, Aloeholz, Sulibancui, sehr wertvolle Edelsteine und andere Wunder“ – Die Darstellung Asiens auf der Mappamondo | 162 | ||
| 4.6 Plus Ultra! Die Entdeckung Afrikas durch die Portugiesen | 167 | ||
| 4.7 Zusammenfassung | 180 | ||
| Teil III: Einzeluntersuchungen.Die Welten der Mappamondo | 187 | ||
| 5 Die Autoritäten auf der Mappamondo | 189 | ||
| 5.1 Die Ich-Form in den Legenden | 193 | ||
| 5.2 „Ich denke nicht, dass ich von Ptolemäus abweiche, wenn ich seiner Cosmographia nicht folge“ – Fra Mauros Diskussionen mit Ptolemäus | 202 | ||
| 5.3 Fra Mauros Kritik an den cosmographi | 206 | ||
| 5.3.1 Der Florentiner Kreis um Niccolò Niccoli | 207 | ||
| 5.3.2 Giovanni Boccaccio und Francesco Petrarca | 217 | ||
| 5.3.3 Zusammenfassung | 223 | ||
| 5.4 L’ attitude toute d’hésitations et de doutes | 224 | ||
| 6 Die Grundstruktur der Welt auf der Mappamondo | 227 | ||
| 6.1 Die Raumaufteilung mittelalterlicher Mappae mundi | 227 | ||
| 6.1.1 Das T-O-Schema mittelalterlicher Mappae mundi | 228 | ||
| 6.1.2 Die Aufteilung der Welt – materia tediosa | 234 | ||
| 6.2 Das irdische Paradies | 242 | ||
| 6.2.1 Das irdische Paradies auf der Mappamondo | 245 | ||
| 6.2.2 Das irdische Paradies in der christlichen Tradition | 246 | ||
| 6.2.3 Die traditionelle Einzeichnung des irdischen Paradieses und dessen Neusituierung im 15. Jahrhundert | 251 | ||
| 6.2.4 „Non omnium, que sub celo et in celo fifiunt, mortales notitiam habent …“ – Eneas Silvius Piccolomini auf der Suche nach dem Paradies | 258 | ||
| 6.2.5 Das irdische Paradies im Kontext der Mappamondo | 263 | ||
| 6.3 Jerusalem auf der Mappamondo | 267 | ||
| 6.3.1 Die Bedeutung Jerusalems in der christlichen Tradition | 267 | ||
| 6.3.2 Die Verschiebung Jerusalems durch Fra Mauro | 271 | ||
| 6.4 Zusammenfassung | 275 | ||
| 7 Das Verschwinden der Monster | 281 | ||
| 7.1 Die frühen Berichte über die Wundervölker und ihre Weitergabe an das Mittelalter | 284 | ||
| 7.2 Kritik an den Wundervölkern in der Antike und ihre Rezeption in der Renaissance | 288 | ||
| 7.3 Augustinus und die christliche Monstertradition | 293 | ||
| 7.4 Fra Mauros Skepsis bezüglich der Wundervölker | 298 | ||
| 8 Der Presbyter Johannes | 307 | ||
| 8.1 Die mittelalterliche Johanneslegende | 308 | ||
| 8.2 Neue Nachrichten im 15. Jahrhundert | 311 | ||
| 8.3 Der Presbyterkönig in der Kartographie | 316 | ||
| 8.4 Äthiopien – Das Reich des Presbyterkönigs auf der Mappamondo | 319 | ||
| 8.4.1 DIAB | 324 | ||
| 8.4.2 Der vierte Kontinent | 330 | ||
| 9 Schluss: „Die Fähigkeit, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken…“ Der Möglichkeitssinn auf der Mappamondo | 337 | ||
| 10 Literaturverzeichnis | 351 | ||
| 10.1 Nachschlagewerke | 351 | ||
| 10.2 Quellen | 352 | ||
| 10.3 Weitere Literatur | 361 | ||
| 11 Abbildungen | 391 | ||
| 12 Danksagung | 405 | ||
| 13 Personenregister | 409 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish