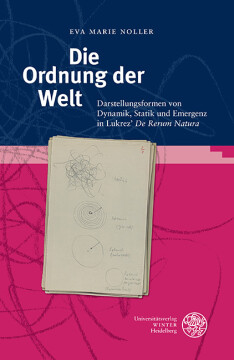
BUCH
Die Ordnung der Welt
Darstellungsformen von Dynamik, Statik und Emergenz in Lukrez’ ‚De Rerum Natura‘
Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften, Neue Folge, 2. Reihe, Bd. 158
2019
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Lukrez’ ‚De Rerum Natura‘ beschreibt und erklärt den Kosmos und alles in ihm Befindliche als geordnete Zusammensetzung von Atomen. Diese ebenso einfache wie grundlegende Feststellung dient als Ausgangspunkt der vorliegenden Studie. In einer Lektüre der in den ersten beiden Büchern von ‚De Rerum Natura‘ entwickelten Atomlehre wird herausgearbeitet, wie sich ein spezifisch lukrezischer Ordnungsbegriff im Spannungsfeld von Statik und Dynamik konturiert. Im Zentrum der Studie steht die sprachliche Verfassung dieser Ordnungsformen. Untersucht wird, wie es mittels der Figuren der Analogie, der Metapher und des Vergleichs gelingt, die unsichtbare Ebene der Welt anschaulich zu machen und so den atomaren Kosmos als einen geordneten zu vermitteln. Dazu werden u.a. die Buchstabenanalogien und die Kinetik auf ihre Ordnungs- und Darstellungsprinzipien hin untersucht. Diese werden in einem Ausblick auf das gesamte Werk als elementare Bestandteile der ästhetischen, philosophischen und didaktischen Verfassung des lukrezischen Lehrgedichts erkennbar.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Danksagung | 5 | ||
| Inhalt | 7 | ||
| 1 Einleitung | 9 | ||
| 1.1 Problemskizze: Wie werden Dinge? | 9 | ||
| 1.2 Forschungsüberblick | 12 | ||
| 1.2.1 Philosophische Ansätze | 14 | ||
| 1.2.2 Literaturwissenschaftliche Ansätze | 18 | ||
| 1.3 Gegenstand und Methode der Arbeit | 28 | ||
| 1.3.1 Ordnung – Zu Terminologie und Begriff | 28 | ||
| 1.3.2 Ordnung im philosophischen Diskurs der Antike | 31 | ||
| 1.3.3 Theoretische Annäherungen an Ordnung | 44 | ||
| 1.4 Gliederung der Arbeit | 52 | ||
| 2 Elemente der Ordnung. Die Buchstabenanalogien | 55 | ||
| 2.1 Überblick: Buchstaben, Atome und Ordnung | 55 | ||
| 2.2 „Uncertain terrain“. Epikureismus und Sprachtheorie | 60 | ||
| 2.3 Die Anschaulichkeit der Ordnung: Fragen und Thesen | 61 | ||
| 2.4 Die Analogie als epistemologisches Organon | 63 | ||
| 2.5 Das ,Mehr‘ der Ordnung | 69 | ||
| 2.5.1 Unzureichende Ordnung (I): Pluralistische Welterklärungen | 69 | ||
| 2.5.2 „Nostris in versibus ipsis“. Der Bezugspunkt der Analogie | 75 | ||
| 2.5.2.1 Vorsokratische Ordnungsformen: σχῆμα – τάξις – θέσις | 77 | ||
| 2.5.3 Welt vs. Text. Unterscheiden und Ordnen | 80 | ||
| 2.6 ,Flamme‘ und ,Stamm‘. Die Bezeichnung der Ordnung | 88 | ||
| 2.6.1 Unzureichende Ordnung (II): Anaxagoras’ Welterklärung | 88 | ||
| 2.6.2 „Paulo inter se mutata“. Vertauschung als Ordnungsprinzip | 90 | ||
| 2.7 Die Differenz der Ordnung | 97 | ||
| 2.8 Der Ausdruck der Ordnung | 100 | ||
| 2.8.1 Dinge zum Ausdruck bringen: Ordnung und Referenz | 100 | ||
| 2.8.2 Das lukrezische Kompositionalitätsprinzip | 104 | ||
| 3 Ordnung und Anfang | 107 | ||
| 3.1 Ordnung und die Frage nach dem ,Davor‘ | 107 | ||
| 3.1.1 „Rerum natura und De Rerum Natura“. Die Erzählbarkeit des Kosmos | 107 | ||
| 3.1.2 Grundaxiome und Setzungen | 110 | ||
| 3.1.3 „Principium und exordium“. Der Anfang des Anfangs | 111 | ||
| 3.2 Materie / Raum. Über das Anfangen und Unterscheiden | 114 | ||
| 3.2.1 Im Inneren der Dinge: materies und secreta facultas | 114 | ||
| 3.2.2 Das „inane“ und die Differenz | 116 | ||
| 3.3 Materie und Raum (I). Über die Verstetigung von Grenzen | 121 | ||
| 3.3.1 Die Definition der Grenze | 121 | ||
| 3.3.2 Nach der Grenze: „Corpus inani distinctumst“ | 123 | ||
| 3.4 Materie und Raum (II). Leere, Grenze und Didaxe | 124 | ||
| 3.4.1 „Nec refert quibus adsistas regionibus“. Im (leeren) Raum | 124 | ||
| 3.4.2 „Dispellere und suppeditare“. Die Unendlichkeit der Materie | 128 | ||
| 3.4.2.1 „Exiguum horai sistere tempus“. Ordnung auf Zeit | 128 | ||
| 3.4.2.2 „Sagaci mente locare“. Ein Sinn für Ordnung? | 130 | ||
| 3.5 Schluss: Den Anfang machen | 137 | ||
| 4 Ordnung und Abweichung | 139 | ||
| 4.1 Anfangen durch Abweichen | 139 | ||
| 4.2 Die Bewegung der Ordnung | 147 | ||
| 5 Die Ordnung der Dinge (I) | 151 | ||
| 5.1 Im Inneren der Atome | 151 | ||
| 5.1.1 Exkurs: „De rerum mixtura“. Selbstreflexivität und Emergenz | 161 | ||
| 5.2 Die Kritik der Ordnung | 164 | ||
| 5.2.1 Die implizite Ordnung der Welt | 164 | ||
| 5.2.2 Die „correctio“ der Ordnung | 167 | ||
| 5.2.3 Die Effekte der Ordnung | 172 | ||
| 5.3 Die Mechanismen der Ordnung | 174 | ||
| 5.4 Schluss: ,Richtige‘ und ,falsche‘ Ordnung | 180 | ||
| 6 Die Ordnung der Dinge (II) | 183 | ||
| 6.1 In Ordnung bringen. Atomformen und atomare Verbindungen | 183 | ||
| 6.2 Die Arithmetik der Ordnung | 188 | ||
| 6.3 Die Berechenbarkeit der Ordnung | 197 | ||
| 6.3.1 „Glomeramen in unum“. Ordnung, Mischung, Ballung | 204 | ||
| 6.3.2 „Anything goes?“ Die „ratio“ der Ordnung | 207 | ||
| 6.3.2.1 „Creare“ und „conservare“. Perspektiven auf Ordnung | 207 | ||
| 6.3.2.2 „Eadem ratio res terminat“. Gesetz und Ordnung | 211 | ||
| 6.4 Über das Auflösen | 218 | ||
| 7 Schluss | 227 | ||
| 7.1 Die Ordnung der Welt – Rückblick | 227 | ||
| 7.2 Die Ordnung der Welt – Ausblick | 232 | ||
| Bibliographie | 241 | ||
| Indizes | 251 | ||
| Rückumschlag | 258 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish