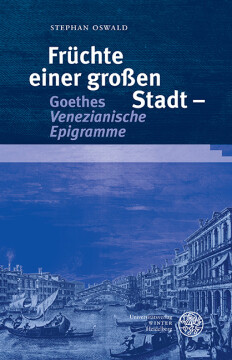
BUCH
Früchte einer großen Stadt – Goethes ‚Venezianische Epigramme‘
Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800. Ästhetische Forschungen, Bd. 33
2014
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Seit ihrem Erscheinen haben Goethes ‚Venezianische Epigramme‘ Unverständnis und Befremden ausgelöst – eine Situation, die bis heute andauert. Dabei bietet der Zyklus Gelegenheit, neben dem Werk selbst bislang wenig bekannte Aspekte aus dem werk- und lebensgeschichtlichen Zusammenhang näher zu beleuchten. Vor dem Hintergrund des aus unbekannten Quellen rekonstruierten zweiten Venedigaufenthalts wird der Zyklus erstmals einer umfassenden Gesamtanalyse unterzogen. Goethes Orientierung am spätlateinischen Vorbild Martial schlägt sich in Distichen zu Politik und Religion, Erotik und Sexualität nieder, in denen sich radikale, mit dem gängigen Goethebild schwer zu vereinbarende Positionen artikulieren. Einen zentralen Motivkomplex bildet Venedig als „Große Stadt“, die Goethe bereits in einer Reihe von typischen Zügen erfasst. Damit stellt der Zyklus eine Vorform von Großstadtdichtung dar, die im Epigramm die lyrische Form findet, um das Punktuelle, Fragmentarische und Unabgeschlossene der Stadtwahrnehmung dichterisch gelungen auszudrücken.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Inhalt | 5 | ||
| Vorwort | 9 | ||
| Einleitung | 11 | ||
| Venedig | 21 | ||
| 1 Vorgeschichte einer ‚unfreiwilligen‘ Venedigreise | 21 | ||
| 2 Il Barone Gaeta – ein deutscher Tourist in Venedig | 31 | ||
| Fremdenregister der Staatsinquisition und Logis am Canal Grande | 31 | ||
| Die Hotelrechnungen und Goethes Ausgabenbuch | 34 | ||
| Der Lohnbediente Mitter | 37 | ||
| 3 Kontaktsperre in Venedig | 41 | ||
| Der Verdacht | 45 | ||
| 4 Geschichte des Marquis de Bombelles | 51 | ||
| Der französische Botschafter in Venedig | 51 | ||
| Wiedersehen in Frankreich | 56 | ||
| 5 Die Wirbel-Theorie | 63 | ||
| Ein Zufallsfund auf dem Lido | 63 | ||
| Goethes anatomische Studien | 68 | ||
| Die Auseinandersetzungen mit Oken | 72 | ||
| 6 Ältere Gemälde. Venedig 1790. Ein Kursus in Kunstgeschichte | 83 | ||
| Goethes Besichtigungsprogramm und sein Kunstführer | 83 | ||
| Das Gegenstandsproblem in der christlichen Kunst | 89 | ||
| Geschichte des Colorits | 95 | ||
| Venezianische Epigramme | 97 | ||
| 7 Antike Epigrammatik in Weimar | 97 | ||
| 8 Zeitgenössische Epigrammtheorie – Herder versus Lessing | 107 | ||
| 9 Das Vorbild Martial – die unterschlagene Tradition | 115 | ||
| H. J. Heller | 116 | ||
| Emil Ermatinger | 117 | ||
| Ernst Maa | 118 | ||
| Kinder einer anspruchslosen Muse vs. der Heine des Altertums | 121 | ||
| Otto Seel | 122 | ||
| Neuer Deutungsansatz – Niklas Holzberg | 126 | ||
| Gewandelte Beurteilung des Vorbildcharakters | 129 | ||
| Liebesepigramme in antiker Manier | 133 | ||
| 10 Biographische Deutung der Epigramme – Verfechter und Widersacher | 139 | ||
| 11 Die Komposition des Zyklus | 153 | ||
| Die Frage der Anordnung: Zufallsprinzip oder poetische Absicht | 153 | ||
| Arbeit an der Komposition des Zyklus | 160 | ||
| Makrostruktur des Zyklus | 166 | ||
| Anfang und Ende des Zyklus – die Rahmenstruktur der Epigramme | 170 | ||
| 12 Johann Caspar Lavater – eine unsichtbare Präsenz | 173 | ||
| Lavater und Goethe: das Ende einer Freundschaft | 173 | ||
| Der Lavater-Komplex in den Venezianischen Epigrammen | 179 | ||
| 13 Reimarus-Reminiszenzen | 193 | ||
| 14 Die Eröffnung des Zyklus: Reisethematik und Ankunft | 203 | ||
| Das Einleitungsepigramm | 203 | ||
| Reisethematik und Ankunft in Venedig | 209 | ||
| 15 Schwärmer und andere Revolutionäre | 217 | ||
| Gefühlvolle Schwärmer | 217 | ||
| Politische Schwärmer | 221 | ||
| Das 55. Epigramm | 236 | ||
| 16 Das leidige Thema Religion | 243 | ||
| Ein aufgeklärter Protestant in Italien | 253 | ||
| Die Brotverwandlung | 257 | ||
| Die Religion mit den eigenen Waffen schlagen – mit Bibelzitaten gegen die Kirche | 260 | ||
| Vom Kreuz zur Korruptel | 269 | ||
| 17 Das Pilgermotiv | 275 | ||
| Schillers Gedicht Der Pilgrim | 280 | ||
| 18 Das Doppelepigramm 34 a und b – Danksagung und Huldigung | 283 | ||
| 19 Die Gauklerin Bettine | 289 | ||
| Das venezianische Gauklermädchen Bettina | 289 | ||
| Die Gauklerin Bettine | 292 | ||
| Bettine erotisch | 305 | ||
| Bettine – die venezianische Schwester Mignons | 310 | ||
| 20 Frauenfiguren | 313 | ||
| Prostitution in Venedig | 313 | ||
| Lazerten | 318 | ||
| Johann Caspar Goethe auf einem venezianischen Prostituiertenball | 325 | ||
| Invektiven gegen die bürgerliche Ehe | 328 | ||
| Christiane Vulpius und der Sohn August | 337 | ||
| 21 Muße, Langeweile und andere Formen des Untätigseins | 345 | ||
| 22 Bilder der Großen Stadt | 357 | ||
| 23 Großstadt Venedig | 365 | ||
| Venedig | 365 | ||
| Gaukler und Akrobaten, Bettler und Prostituierte | 369 | ||
| Das Bild der Menge | 371 | ||
| Stadt versus Natur | 373 | ||
| Die Ware | 374 | ||
| 24 Poetologische Reflexionen, oder: das Epigramm über sich selbst | 379 | ||
| Gattungsspezifische Züge | 380 | ||
| Mythologie | 388 | ||
| Der Dichter | 390 | ||
| 25 Finale | 401 | ||
| Goethe, ein früher Flaneur | 409 | ||
| Großstadt-Epigramme bei Waiblinger und Platen | 410 | ||
| 26 Bibliographie | 415 | ||
| 27 Bildanhang | 425 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish