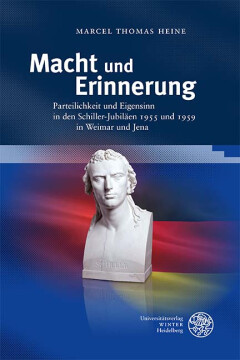
BUCH
Macht und Erinnerung
Parteilichkeit und Eigensinn in den Schiller-Jubiläen 1955 und 1959 in Weimar und Jena
Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800. Ästhetische Forschungen, Bd. 37
2021
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Friedrich Schiller diente seit seinem Tod im Jahr 1805 als Erinnerungsfigur vielen kulturellen, ideologischen und politischen Zielen. Diese Arbeit verfolgt den roten Faden der Erinnerung durch die Schiller-Jubiläen der Jahre 1955 und 1959 in der DDR. Jedoch stehen nicht allein der durch die SED geformte Schiller im Mittelpunkt, sondern auch die Möglichkeiten einer freien Erinnerung unter den Bedingungen der Diktatur. Mit der Betrachtung des universitären Schiller-Gedenkens in Jena werden die Auswirkungen und Grenzen der Deutungshoheit der SED nachvollziehbar. Gleichzeitig gewährt dies einen Einblick in das Spannungsfeld zwischen Parteinahme und Selbstbehauptung, in das individuelle Akteure in Diktaturen geraten. Herrschaft, das ist die grundlegende Prämisse dieser Untersuchung, ist keine Einbahnstraße von der Spitze zur Basis, sondern entsteht in der Wechselbeziehung zwischen der historischen Situation, dem Regime und seiner Weltdeutung sowie den Individuen und ihrem Eigensinn.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Einleitung: Erinnerung und Autorität | 9 | ||
| Vom Tod eines Dichters | 9 | ||
| Nachleben: die zweite Geburt des Friedrich Schiller | 12 | ||
| Zum Gegenstand dieser Arbeit | 15 | ||
| Macht: eine Begriffsbestimmung | 17 | ||
| Gedächtnis- und Erinnerungspolitik: die Schiller-Feiern der SED | 19 | ||
| Der Eigensinn: die akademischen Schiller-Feiern in Jena | 23 | ||
| I Motivation und Ideologie der DDR-Erinnerungskultur | 29 | ||
| 1 Legitimationsdefizit und Erinnerungskultur | 29 | ||
| 1.1 Geisterbeschwörung: Erinnerung und Legitimation | 29 | ||
| 1.2 Demokratischer Abbruch: dieWahlen in der SBZ/DDR 1946-1950 | 33 | ||
| 1.3 Das neue Deutschland: der Staatsgründungsprozess der DDR | 37 | ||
| 1.4 Der Drang nach Teilhabe | 45 | ||
| 2 Modus und Methode der Erinnerung | 51 | ||
| 2.1 Die Ordnung der Geschichte: von Marx und Engels zu Lenin | 51 | ||
| 2.2 Der Feind als zentrale Figur der Legitimation der Einheitspartei | 54 | ||
| II Friedrich Schiller für ein neues Deutschland: dieWeimarer Gedenkreden | 61 | ||
| 1 Für das ganze Deutschland: Schiller und die unteilbare Nation (1955) | 61 | ||
| 1.1 Fürsten, Führer, Kanzler: auf dem Holzweg der deutschen Geschichte | 61 | ||
| Die moderate Stimme: Johannes R. Becher und die guten Bürger | 61 | ||
| Die Stimme des Kampfes: Otto Grotewohl klagt an | 65 | ||
| 1.2 Das andere Deutschland: die Geschichte einer Erlösung | 70 | ||
| Weimarer Revolutionäre | 70 | ||
| Friedrich Schiller und die Bewegungsgesetze der Geschichte | 73 | ||
| Die DDR, Schillers „Traumstaat“ | 75 | ||
| 1.3 Frieden und Verteidigung | 79 | ||
| Im Namen der Heimat: die Militarisierung der Ostdeutschen | 79 | ||
| Die Verteidigung von Schillers „Traumstaat“ | 82 | ||
| Friedrich Schiller als Dichter und Kämpfer | 85 | ||
| 2 Eine neue Macht auf Erden (1959) | 87 | ||
| 2.1 Entstalinisierung und stalinistischeWiedergänger | 87 | ||
| 2.2 Ein Traum ist erfüllt: Alexander Abuschs Staatsrede (1959) | 92 | ||
| Ein alter Feind: zweiWege deutscher Geschichte | 92 | ||
| Ein neues Machtvertrauen: die DDR in ihrer Einzelstaatlichkeit | 96 | ||
| Ein sozialistischesWeltreich von der Elbe bis zum Pazifik | 98 | ||
| Das Rad der Geschichte: Friedrich Schiller geht im Kreis | 105 | ||
| 3 Zurück zur Quelle: Franz Mehring, Friedrich Schiller und die Revolution | 107 | ||
| 3.1 Die Überwindung alter Irrtümer: die SED und Franz Mehring | 107 | ||
| Die Idee der „deutschen Misere“ | 107 | ||
| Auf den Platz verwiesen: die Partei hat das letzteWort | 111 | ||
| 3.2 Im Morast der „deutschen Misere“ | 117 | ||
| Friedrich Schiller und die Französische Revolution | 117 | ||
| Des Dichters Irrweg: zwischen Kant und „deutscher Misere“ | 120 | ||
| Weimarer Klassik im revolutionären Geiste | 126 | ||
| 4 Für den neuen Menschen: der sozialistische Realismus und der neue Leser | 129 | ||
| 4.1 Die Erfindung einer Staatskunsttheorie | 129 | ||
| Deutungshoheit und Vagheit im sozialistischen Realismus | 129 | ||
| Von Moskau nach Berlin: der Import des sozialistischen Realismus | 134 | ||
| 4.2 Volkseigene Kunsttheorie | 136 | ||
| Realismus gegen Formalismus | 136 | ||
| Die schöne Form | 142 | ||
| Typische Forderungen | 144 | ||
| Macht und Kunst: der „Ingenieur der menschlichen Seele“ | 147 | ||
| 4.3 Der neue Mensch des Sozialismus | 151 | ||
| Kanon und Deutung | 151 | ||
| Schillers Tod und der Staatsleser | 154 | ||
| Keine Ruhe im Lesesaal | 158 | ||
| III Jenaer Schiller-Reden | 161 | ||
| 1 Josef Hämel: Schiller als Mensch, Mediziner und Professor (1955) | 161 | ||
| 1.1 Die akademische Lebenswelt der SBZ/DDR (1945-1955) | 161 | ||
| Bildungsbürgertum und Intelligenz der Arbeiterklasse | 161 | ||
| Die Reinigung derWeste: Josef Hämel erfindet sich neu | 166 | ||
| 1.2 Die Ansprache Josef Hämels | 175 | ||
| Der Mensch Friedrich Schiller | 175 | ||
| Schiller als Dichterarzt | 179 | ||
| Friedrich Schiller und die Jenaer Universität | 181 | ||
| Erziehung und Menschenbild | 184 | ||
| Einheit und Freiheit | 189 | ||
| 2 Eigensinnige Parteilichkeit: Joachim Müllers erste Schiller-Rede (1955) | 191 | ||
| 2.1 Ehrgeiz und Opportunismus | 191 | ||
| Aller Neuanfang ist schwer | 191 | ||
| Joachim Müllers Einsatz für ein neues Deutschland | 198 | ||
| 2.2 Ein Versuch über Schiller: Nation, Ästhetik und der neue Mensch | 204 | ||
| Ein deutscher Kämpfer | 204 | ||
| Schillers politisches Leben | 207 | ||
| Schillers Ästhetik als Befreiungsideologie | 211 | ||
| Revolution und ästhetische Erziehung | 215 | ||
| Für die Einheit der Nation: die ästhetische Erziehung und das Volk | 219 | ||
| 3 Hinter Masken: Joachim Müllers zweite Schiller-Rede (1959) | 222 | ||
| 3.1 Auf demWeg zur „sozialistischen Hochschule“ (1955-1959) | 222 | ||
| Die „Verschärfung des Klassenkampfes“ an den Hochschulen | 222 | ||
| Joachim Müller nach 1955 | 228 | ||
| 3.2 Die Antwort eines Germanisten auf parteiliche Kritik | 237 | ||
| Heimkehr: Jena als Schillers Ort derWandlung und Reife | 237 | ||
| Ein Genius zwischen Enthusiasmus und Not | 239 | ||
| Schiller und Goethe: reine Privatsache | 242 | ||
| Professor Müller, versteckt hinter Historizität | 244 | ||
| Spuren der Parteilichkeit | 248 | ||
| Schlussbemerkungen: die Macht der Partei und ihre Grenzen | 255 | ||
| Semiotik der Macht | 255 | ||
| Die Schiller-Jubiläen der DDR in synchroner und diachroner Perspektive | 262 | ||
| Die Instabilität des SED-Staates und der Eigensinn | 266 | ||
| Danksagung | 269 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 271 | ||
| Quellen- und Literaturverzeichnis | 273 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish