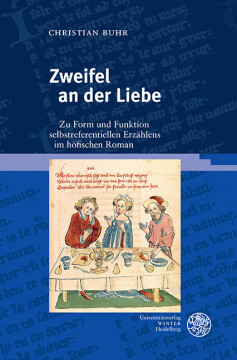
BUCH
Zweifel an der Liebe
Zu Form und Funktion selbstreferentiellen Erzählens im höfischen Roman
Frankfurter Beiträge zur Germanistik, Bd. 57
2018
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Vielen narratologischen Darstellungen gilt literarische Selbstreferentialität als ein wesentliches Kennzeichen neuzeitlicher Dichtung. Im Bereich der Epik wird dann nicht selten behauptet, der ‚Don Quijote‘ sei der allererste Roman, der sich selbst zum Referenzobjekt mache und in diesem Zuge ‚histoire‘ und ‚discours‘ gleichberechtigt nebeneinandertreten lasse. Aufgrund dieses epistemischen Vorbehalts wird jedoch oft übersehen, dass Selbstreferentialität eine grundlegende Möglichkeit jedweden Dichtens darstellt, von der seit Homers ‚Odyssee‘ in verschiedentlicher Weise und in wechselnder Intensität Gebrauch gemacht wurde. Anhand der Analyse exemplarischer mittelhochdeutscher und altfranzösischer Texte erbringt der vorliegende Band den Nachweis, dass auch die höfische Literatur des Mittelalters spezifische Formen selbstreferentiellen Erzählens auszubilden vermochte, und hinterfragt zugleich, warum derartige Phänomene zumeist dort zu beobachten sind, wo von der Liebe gehandelt wird.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | C | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Vorrede und Dank | 5 | ||
| Inhalt | 7 | ||
| 1 Lust am Text | 9 | ||
| 1.1 Textkorpus | 25 | ||
| 1.2 Methodik | 33 | ||
| I ‚Close reading‘ | 36 | ||
| II Implizite und explizite Formen | 36 | ||
| III Selbstreferentialität | 40 | ||
| IV Vertikalität und Horizontalität | 46 | ||
| V Zweifel an der Liebe | 48 | ||
| 2 Narziss im Blumenidyll (‚Flore und Blanscheflur‘) | 53 | ||
| I Kinderminne | 59 | ||
| II Liebescodes | 64 | ||
| III Umkämpfte Fiktion | 69 | ||
| IV Der Pokal | 75 | ||
| V Märchenschluss | 79 | ||
| 3 Muster des Erzählens (‚Aucassin et Nicolette‘) | 89 | ||
| 4 Ein Ende finden (‚Tristan und Isolde‘) | 95 | ||
| 4.1 Béroul | 101 | ||
| I Reiteratives Erzählen | 105 | ||
| II Memoria | 109 | ||
| III Der fehlende Schluss | 113 | ||
| 4.2 Tristan als Narr | 119 | ||
| 4.3 Eilhart von Oberg | 133 | ||
| I Autor, Werk und Überlieferung | 137 | ||
| II Liebe als Lebensgeschichte | 145 | ||
| III Liebe und Wahnsinn | 153 | ||
| IV ‚Wie Keheniß vergieng und Tristrand töttlich wunden enpfieng‘ | 159 | ||
| V Schluss | 164 | ||
| 4.4 ‚Version courtoise‘ | 169 | ||
| 4.4.1 Thomas von Britannien | 171 | ||
| I ‚Desir et voleir‘ | 176 | ||
| II ‚Salle aux images‘ | 187 | ||
| III ‚Tristan le Naim‘ | 194 | ||
| IV Von Anfang und Ende | 198 | ||
| 4.4.2 Gottfried von Straßburg | 205 | ||
| I Entdeckung | 212 | ||
| II Abschied | 217 | ||
| III Die Liebe, unendlich? | 226 | ||
| IV Nach der gestundeten Zeit | 235 | ||
| V Die Grenze des Todes | 241 | ||
| 5 Im Netz der Dinge (‚Cligès‘) | 247 | ||
| I ‚Tristan retourné‘ | 253 | ||
| II Die Kunst des Erzählens | 259 | ||
| III Der Text und sein Doppel | 267 | ||
| 6 Liebe als Spiel (‚Frauendienst‘) | 273 | ||
| I Form | 280 | ||
| II Prolog | 285 | ||
| III Erster Dienst | 287 | ||
| IV Wunschminne und ‚wânwîse‘ | 303 | ||
| V Zweiter Dienst | 316 | ||
| VI Das versäumte Leben | 326 | ||
| 7 Resümee und Ausblick | 335 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 359 | ||
| Literaturverzeichnis | 361 | ||
| Forschungsregister | 395 | ||
| Abbildungsnachweise | 401 | ||
| Backcover | 402 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish