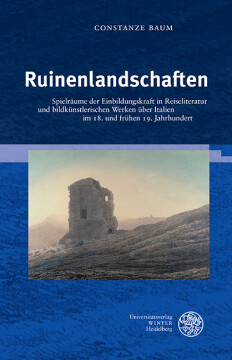
BUCH
Ruinenlandschaften
Spielräume der Einbildungskraft in Reiseliteratur und bildkünstlerischen Werken über Italien im 18. und frühen 19. Jahrhundert
Germanisch-Romanische Monatsschrift. Beihefte, Bd. 51
2014
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Kann man die Wahrnehmungsgeschichte der Ruinen in Italien und deren ästhetische Bedeutung im Wechselspiel von Imagination und Evidenz darstellen? Dieser Aufgabe stellt sich die Studie und bindet dabei sowohl Zeugnisse der europäischen Reiseliteratur des 18. und frühen 19. Jahrhunderts als auch bildkünstlerische Werke in ihre Überlegungen ein. Entlang von Fallstudien, die sich prominenten römisch-antiken Ruinenlandschaften in Italien widmen, wird das Panorama möglicher Wahrnehmungen aufgedeckt. Die Befunde bestätigen Diderots Diktum von den an der Ruine wirkenden Spielräumen der Einbildungskraft: Die Ruine verkörpert für das 18. Jahrhundert einen Schwebezustand zwischen Bedeutungen und Zeiten. Ihre Wahrnehmung unterliegt – eingespannt in die Diskurse von Schönheit und Erhabenheit, Augenblick und Dauer – einem komplexen Transformationsprozess, der weit über emblematische und ikonische Festschreibungen von Vergänglichkeit und Sentimentalem hinausreicht.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Vorwort | VII | ||
| Inhalt | IX | ||
| Erster Teil: Fundamente | 1 | ||
| 1 ›Ruinen des Augenblicks‹ und ›Ruinen der Dauer‹. Das Erdbeben von Lissabon und der Ruinendiskurs | 1 | ||
| 1.1 Ruinenästhetik und das Erdbeben von Lissabon | 1 | ||
| 1.2 Der Augenblick in der Geschichte: Der Ruinendiskurs im Jahr 1755 | 8 | ||
| 1.3 ›Ruinen des Augenblicks‹ und ›Ruinen der Dauer‹ | 12 | ||
| 1.4 Lissabon als Ruine. Die Darstellung des katastrophalen Augenblicks | 14 | ||
| 1.5 Le Bas’ Sonderweg: ›Schöne Trümmer‹ | 18 | ||
| 2 Ruinenlandschaften | 25 | ||
| 2.1 Im Dialog mit der Ruine | 25 | ||
| 2.2 Ruine – Reliquie – Überrest – Spur – Trümmer | 33 | ||
| 2.3 »…Albanos Auge [war] nach der schönsten Ruine der Zeit – wenn man die Erde selber ausnimmt –, nach Italien gerichtet« | 38 | ||
| 3 Landschaftswahrnehmung | 43 | ||
| 3.1 Reiseliteratur und Ruinenlandschaften | 43 | ||
| 3.2 Eine Philosophie der Landschaft | 49 | ||
| 3.3 Ruinenästhetik: Fortgesetzte Betrachtungen | 55 | ||
| 3.3.1 »Die jetzige Aussicht der zertrümmerten Gebäude ist gross und malerisch« | 62 | ||
| 3.3.2 »all magnificence is lost« – Die Ruinierung der Ruine und die Schönheit der Trümmer | 68 | ||
| 3.4 Landschaft mit Buch und Ruinen oder Wer nichts weiß, sieht auch nichts | 72 | ||
| 4 Exkurs: Augenblicke in der Landschaft. Eine Federzeichnung Burys und das Claude-Glas | 81 | ||
| 5 Ruinenlandschaften in der bildenden Kunst | 103 | ||
| 5.1 Prolegomena zu einer Topographie der Ruinen | 103 | ||
| 5.2 Vedute capricciose: Einige Beobachtungen zur Genese von Ruinenbildern zwischen Erfinung und Authentizität | 112 | ||
| 5.3 Bausteine zu einer Geschichte der Ruinendarstellung | 119 | ||
| 5.3.1 Das Buch der Wahrheit – die Ruinen Claude Lorrains | 120 | ||
| 5.3.2 Roma ruinans – Ruinenprojekte der Neuzeit | 123 | ||
| 5.3.3 Ruinen als Architekturprojekte zwischen papierner Phantasie und Baustelle | 132 | ||
| 5.3.4 Der Petersdom als Ruine? Maarten van Heemskerck ruiniert Rom | 137 | ||
| 5.3.5 Dignität der Ruine: Piranesi feiert Roms Ruinen | 146 | ||
| 5.4 Patinierungen | 148 | ||
| 5.4.1 Bildverwitterung bei Piranesi | 148 | ||
| 5.4.2 Textverwitterung bei Goethe | 151 | ||
| 5.4.3 Renaturierung: Bewuchs als Protagonist der Ruinenwahrnehmung | 155 | ||
| 6 Ruinenästhetik im 18. Jahrhundert | 163 | ||
| 6.1 Diderots ›Poetik der Ruinen‹ | 163 | ||
| 6.2 »Il faut ruiner un palais pour en faire un objet d’intérêt.« | 170 | ||
| 6.3 Hirschfelds Theorie der Gartenkunst oder Anleitung, wie man (k)eine Ruine baut. | 172 | ||
| 6.4 Das verkehrte Kolosseum – eine selbstgemachte Ruinierung | 174 | ||
| Zweiter Teil: Fallstudien | 183 | ||
| 7 Das Amphitheater von Verona als Palimpsest | 183 | ||
| 7.1 Stimmengewirr auf dem Theater | 183 | ||
| 7.2 Die Arena di Verona als Neubauruine | 193 | ||
| 7.3 Heinrich Heine in Verona | 195 | ||
| 7.3.1 Annäherungen an die Stadt und das Amphitheater | 195 | ||
| 7.3.2 »Tolle Trümmer« – Blick zurück in die Geschichte | 198 | ||
| 7.3.3 Ruine als Schrift – sprechende Trümmer | 199 | ||
| 7.3.4 Heines Antike | 199 | ||
| 7.3.5 Produktive Schrumpfungen | 200 | ||
| 7.3.6 Die antike Ruine als Bühne träumerischer Anverwandlung | 202 | ||
| 7.4 Johann Wolfgang Goethe und die erste antike Ruine in Italien | 204 | ||
| 7.4.1 Anfahrt auf Verona | 204 | ||
| 7.4.2 Blick vom Kraterrand | 205 | ||
| 7.5 Karl Philipp Moritz und der tiefe Trichter der Einbildungskraft | 207 | ||
| 7.6 »Silence reigned undisturbed the awful ruins« – William Beckford in der Arena | 209 | ||
| 8 Roms ruinierte Rotonden | 213 | ||
| 8.1 »… ruin, ruin, ruin, all about it« – Rom als Ruinenlandschaft | 213 | ||
| 8.2 Das Pantheon als Ruine | 223 | ||
| 8.3 Prächtige Verwüstung – die römische Ruine bei Nacht | 233 | ||
| 8.4 Seitenblicke auf das Pantheon | 236 | ||
| 8.5 »Being forlorn and dismal« – ein missglückter Pantheonbesuch | 239 | ||
| 8.6 Aufs Dach gestiegen – Ardinghellos PantheonErlebnis | 241 | ||
| 8.7 ›Aqua alta‹ – Das Pantheon und die Flutkatastrophe 1805 | 245 | ||
| 9 Pompejis ›Ruinen des Augenblicks‹ | 249 | ||
| 9.1 Pompejanische Tagträume | 255 | ||
| 9.2 Im Bann der Isis: Rekonstruktive Phantasie in der "Voyage Pittoresque" | 261 | ||
| 9.3 Ruinierte ›rêverie‹ und gemischte Gefühle | 264 | ||
| 9.4 »Ghostly ruins« | 269 | ||
| 9.5 Pittoreskes Pompeji? | 270 | ||
| 9.6 Moritz fehlt der Nebel der Vorzeit, Goethe die Größe | 275 | ||
| 10 »... tenet nunc Parthenope« – Vergils Grab | 283 | ||
| 10.1 Ruinenreliquie – Ein Lorbeerzweig für Friedrich den Großen | 289 | ||
| 10.2 Das Grab des Vergil als Motiv in der Reiseliteratur vor 1755 | 303 | ||
| 10.3 Nach 1755: ›postwilhelminische‹ Vergilgrabbesucher | 310 | ||
| 10.4 Die Wandelbarkeit der Ruine – Bilder vom VergilGrab | 323 | ||
| 11 Ruinenwahrnehmung – Ruinenlandschaften | 327 | ||
| 12 Literaturverzeichnis | 335 | ||
| 12.1 Quellen | 335 | ||
| 12.2 Forschungsliteratur | 340 | ||
| Abbildungsnachweise | 353 | ||
| Register | 359 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish