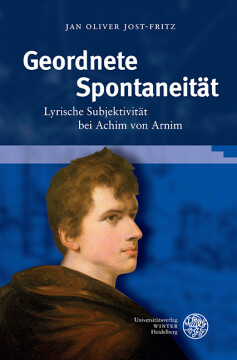
BUCH
Geordnete Spontaneität
Lyrische Subjektivität bei Achim von Arnim
Germanisch-Romanische Monatsschrift. Beihefte, Bd. 63
2014
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Die Lyrik Achim von Arnims ist immer noch das Stiefkind der sonst recht regen Diskussion um Arnim im Besonderen und die Romantik im Allgemeinen. Seine Abwesenheit im Kanon romantischer Lyrik, eine nicht immer glücklich verlaufene Editionsgeschichte, aber auch der bisweilen etwas spröde Charakter vieler Gedichte selbst standen einer ausführlichen Auseinandersetzung mit dem thematisch und formal vielfältigen Werk lange im Wege. Dabei zeigt ein Blick gerade auf die Eigenheiten von Arnims Œuvre, dass er auch im Bereich der Lyrik als eine Hauptgestalt der deutschen Romantik gelten kann. Statt ein Medium subjektiven Selbstausdrucks zu sein, ist Arnims Lyrik eine Art Entdeckungsreise zum Grund des Ichs selbst, zu einem Grund, der phänomenologisch erkundet wird. Es ist diese Phänomenologie des Ichs, die in der vorliegenden Untersuchung an einer Auswahl von Arnims poetologischen Schriften und einer Auswahl aus den Gedichten herausgearbeitet wird und die Arnims Lyrik an die Seite romantischer Lyriker wie Novalis, Tieck, Brentano oder Eichendorff stellt.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Anmerkung | 7 | ||
| 1 Arnims Lyrik: Umrisse einer Poetik | 9 | ||
| 1.1 Subjekt und Subjektlosigkeit. Diskussionsansätze zu Arnims Lyrik | 9 | ||
| 1.1.1 Subjektivität als Perspektive | 9 | ||
| 1.1.2 „Bei Arnim’s Gedichten komme ich auch auf besondere Gedanken | 12 | ||
| 1.1.3 Poetik zwischen Herz und Hirn | 18 | ||
| 1.2 Arnims romantische Sprachtheorie | 24 | ||
| 1.2.1 Hypothese der Spontaneität als Fluchtpunkt der Arnimschen Poetologie | 24 | ||
| 1.2.2 Lyrische Sprache zwischen Musik und Gedanke | 31 | ||
| 1.2.3 Empfindung und Artikulation. Zum Verhältnis von Gefühl und Gestaltung | 36 | ||
| 1.3 Poetik zwischen Spontaneität und Arbeit | 43 | ||
| 1.3.1 Spontaneität als (Sprach-)Witz | 43 | ||
| 1.3.2 Arbeit und ihre Bedeutung im Kontext der Poetologie Arnims | 53 | ||
| 1.4 Poetische Form und Diskursivität des Gedichts | 62 | ||
| 2 Selbstbehauptung und Transzendenz | 73 | ||
| 2.1 Rausch und Subjektlosigkeit | 73 | ||
| 2.2 Metaphern und poetische Kontrolle | 81 | ||
| 3 Psychologie, Subjektivität und Erlösung | 93 | ||
| 3.1 Die Tiefe des Subjekts | 93 | ||
| 3.1.1 Romanze und Subjektivität | 93 | ||
| 3.1.2 Das „leere Herz“ und die Einbildungskraft | 96 | ||
| 3.1.3 Nachtrauschen | 102 | ||
| 3.1.4 Das Unbewusste und seine Diskursivierung | 107 | ||
| 3.2 Die Rose | 110 | ||
| 3.2.1 Arnims ästhetische Geographie | 110 | ||
| 3.2.2 Triebnatur und atmosphärischer Raum | 115 | ||
| 3.2.3 Individuationsversuch und Triebnatur | 121 | ||
| 3.2.4 Verweigerte Erlösung | 130 | ||
| 3.3 Verwirklichte Erlösung in Der Rheinfall | 134 | ||
| 3.3.1 Selbstbestimmung als Erlösungsvoraussetzung | 134 | ||
| 3.3.2 Die Metaphorik des Wohnens und des Übergangs | 138 | ||
| 3.3.3 Die verwirklichte Erlösung | 143 | ||
| 4 Bildung und Apotheose. Arnims Sonette | 145 | ||
| 4.1 Arnims Künstlerroman in Sonetten | 145 | ||
| 4.1.1 Einleitung | 145 | ||
| 4.1.2 Das Formzitat als Konstruktionsprinzip: Sonett und Künstlerroman | 147 | ||
| 4.1.3 Die Parodie des Epos | 155 | ||
| 4.2 Der Heidelberger Literaturstreit | 159 | ||
| 4.2.1 J. H. Voß’ Kritik romantischer Re-Mystifizierung der Aufklärung | 159 | ||
| 4.2.2 Formation der klassischen Position bei Vo | 174 | ||
| 4.2.3 Voß’ Sonett-Polemik | 177 | ||
| 4.3 Mythologie der Subjektivität | 182 | ||
| 4.3.1 Inspiration und Emotionspoetik | 182 | ||
| 4.3.2 Die ‚bacchischen’ Sonette | 189 | ||
| 4.3.3 Nihilismus und Selbstdestruktion | 212 | ||
| 4.4 Autonomie und Apotheose | 220 | ||
| 4.4.1 Bildungsidee und Liebe | 220 | ||
| 4.4.2 Die Neue Mythologie der Subjektivität | 224 | ||
| 5 Subjektkonstitution zwischen Himmel und Erde | 229 | ||
| 5.1 Metaphysik des Schwebens | 229 | ||
| 5.2 Himmel und Erde | 231 | ||
| 5.3 Aufforderung und Subjektivität | 239 | ||
| 6 Zusammenfassung | 247 | ||
| 7 Verwendete Literatur | 251 | ||
| 7.1 Quellen | 251 | ||
| 7.2 Forschungsliteratur | 256 | ||
| 7.3 Abbildungen | 267 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish