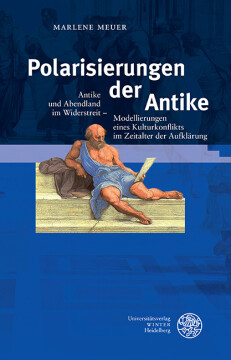
BUCH
Polarisierungen der Antike
Antike und Abendland im Widerstreit – Modellierungen eines Kulturkonflikts im Zeitalter der Aufklärung
Germanisch-Romanische Monatsschrift. Beihefte, Bd. 85
2017
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Die Antike ist zur Aufklärungszeit das bevorzugte Medium der zeitgenössischen Selbstauslegung und damit eine Fiktion mit Interessencharakter: Sie wird zur Meistererzählung im Prozess der kulturellen und politischen Selbsterfindung Europas. Die Studie fächert systematisch die Beziehungsmöglichkeiten von Antike und Christentum auf und rückt eine davon ins Zentrum: polarisierende Überordnungen der Antike in historischen Vergleichsmodellen. Anhand von eingehenden Textanalysen zeigt sie, dass dieses kulturelle Konfliktmuster die aufklärerischen Diskurse weitgehend durchdringt – Geschichtsdenken, Anthropologie, Kosmologie, Theologie, Poetologie, Gesellschafts-, Rechts- und Staatsphilosophie. Die kulturelle Konfliktinszenierung und die polarisierende Indienstnahme der Antike ist für zentrale Vertreter der Aufklärung insofern auf genuine Weise charakteristisch, als sie mit dem aufklärerischen Leitbegriff der ‚Kritik‘ korrespondiert: Kritik beruht auf polaren Beziehungsformen.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | C | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Einleitung | 9 | ||
| I GRUNDLEGUNG: Typologie der Aneignungsstrategien und Begegnungsformen zwischen Antike und Christentum | 49 | ||
| 1. Christlich perspektivierte Unterordnungen der griechisch-römischen Kultur seit der Spätantike | 55 | ||
| 2. Fallstudie: Zwei griechische Figuren im Wandel der Zeit: Odysseus und Sokrates von Dante bis Sebastian Brant | 91 | ||
| 3. Überordnungen der griechisch-römischen Kultur in antik-zeitgenössischen und antik-christlichen Vergleichsmodellen seit der Spätantike | 129 | ||
| II HISTORISCH-SYSTEMATISCHE EINFÜHRUNG: Die Antike als kulturelles Leitmodell und als Sinnbild der Freiheit im Jahrhundert der Aufklärungsbewegung | 149 | ||
| 1. Die aufklärerische Neuformierung des Antikediskurses nach dem Ende der Querelle des ‚Anciens et des Modernes‘ | 151 | ||
| 2. „Winckelmann und sein Jahrhundert“ – die Neubegründung der Antikerezeption während der Jahrhundertmitte | 171 | ||
| III DIE ANTIKE IM ZEITGENÖSSISCHEN GESCHICHTSDENKEN: Aufklärerische Geschichtsideologie, klassizistische Geschichtsverklärung, antichristliche Gedächtnispolitik und idealistische Geschichtsphilosophie | 181 | ||
| 1. Rousseaus aufklärerische Geschichtsideologie: ‚Anciens und Modernes‘ im geschichtsphilosophischen Entwicklungsmodell des ‚Discours sur l’inégalité‘ | 185 | ||
| 2. Winckelmanns klassizistische Geschichtsverklärung: Von der Idealisierung der Griechen zur Idealisierung der griechischen Geschichte | 227 | ||
| 3. Voltaires antichristliche Gedächtnispolitik: Der ‚Éloge historique de la Raison‘ | 235 | ||
| 4. Geschichtliche Differenzerfahrung und Griechentum als sentimentalische Gegenwelt in Schillers Lyrik und Philosophie | 247 | ||
| IV THEMENBEREICHE: Antik-zeitgenössische und antik-orthodoxe Konfliktinszenierungen im aufklärerischen Antikediskurs | 287 | ||
| 1. Anthropologie: Anakreontische Aufwertung des Menschen als Sinnenwesens, epikureische Glückserfüllungen und ganzheitliche Entfaltung im Diesseits | 291 | ||
| 2. Kosmologie und Theologie: Materialismus, Pantheismus und monistische Variationen | 295 | ||
| 3. Ein kosmologischer Sonderfall – Platonismus: Pluralisierungen, Popularisierungen, Polarisierungen | 311 | ||
| 4. Genieästhetik und Poetologie: Eroberung der Schöpferkraft, Sakralisierung der Inspiration und der Verkündungsauftrag des Dichters und der Dichtung | 345 | ||
| V SCHWERPUNKTANALYSE POLITIK: Die Reetablierung säkularer Herrschaftslegitimation im Medium politisierter Antikerezeption | 357 | ||
| 1. Exkurs: Historische Korrelationen von Religion und Politik | 361 | ||
| 2. Rousseaus politiktheoretische Grundlegung innerweltlicher Argumentationsmuster im ‚Contrat social‘ | 383 | ||
| 3. Popularisierung republikanischen Denkens in der zeitgenössischen Tragödiendichtung – Voltaire, Lessing, Schiller | 427 | ||
| 4. Historische Vollkommenheit und zeitloser Vorbildcharakter: Die gesellschaftspolitischen Implikationen der antiorthodox-philhellenischen Philosophie in Hölderlins Tübinger Hymnen | 461 | ||
| 5. Politische Irrwege griechischer „Schwärmer“ – Hölderlin reflektiert das Scheitern der Französischen Revolution | 481 | ||
| VI ENTWICKLUNGSVERLÄUFE: Neue Ideologien, Distanzierungen, synthetisierende Versöhnungen | 523 | ||
| 1. Neue Ideologien im revolutionären Frankreich | 527 | ||
| 2. Distanzierungen vom Antikekult und Relativierungen des Antikebildes bei Lessing und Schiller | 533 | ||
| 3. Neue Synthesen und Versöhnungen des antikchristlichen Kulturkonflikts in Hölderlins Spätwerk | 549 | ||
| Ausblick | 599 | ||
| Literaturverzeichnis | 617 | ||
| Backcover | 665 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish