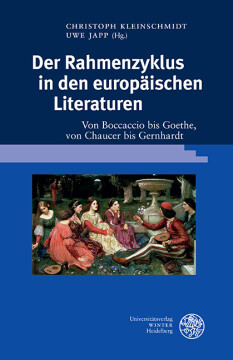
BUCH
Der Rahmenzyklus in den europäischen Literaturen
Von Boccaccio bis Goethe, von Chaucer bis Gernhardt
Herausgeber: Kleinschmidt, Christoph | Japp, Uwe
Germanisch-Romanische Monatsschrift. Beihefte, Bd. 91
2018
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Seit Giovanni Boccaccios ‚Decameron‘ hat sich das wiederkehrende Erzählen in geselligen Kreisen zu einem Erfolgsmodell in den europäischen Literaturen entwickelt. Angefangen von Geoffrey Chaucers ‚Canterbury Tales‘ über Johann Wolfgang Goethes ‚Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten‘ bis hin zur ironischen Adaption in Robert Gernhardts ‚Florestan-Fragmenten‘ wurde diese narrative Großform immer wieder aufgegriffen und in ihren Grundbedingungen – den Umständen der Zusammenkunft, der Auswahl der Erzählerinnen und Erzähler, der Aushandlung literarischer Standards und der Festlegung auf bestimmte Erzählgenres – variiert. Der Band spannt einen weiten Bogen vom Mittelalter bis in die Gegenwart und sondiert systematisch die verschiedenen Bezugnahmen der Rahmenzyklen aufeinander. Mit Beiträgen aus der Anglistik, der Romanistik und Germanistik vereint er erstmals Perspektiven unterschiedlicher Fachdisziplinen auf die vielschichtige Form des rahmenzyklischen Erzählens.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| UWE JAPP: Der Rahmenzyklus in den europäischen Literaturen. Von Boccaccio bis Goethe, von Chaucer bis Gernhardt. Einleitung | 9 | ||
| JAN SÖFFNER: Kann man den Zufall rahmen? Überlegungen zu Giovanni Boccaccios „Decameron“ | 25 | ||
| ANDREW JAMES JOHNSTON: Den Rahmen sprengen. Die „Canterbury Tales“ von Geoffrey Chaucer | 41 | ||
| CHRISTINE OTT: Geburt des Kunstmärchens aus dem Rahmen der Novelle. „Das Märchen der Märchen“ von Giambattista Basile | 59 | ||
| FRANK ESTELMANN: Konversationsrahmen und Krawallkoffer. Der Rahmenzyklus als kultureller und interkultureller Text in Paul Scarrons „Roman comique“ | 79 | ||
| CHRISTOPH KLEINSCHMIDT: „Verwirrungen und Mißverständnisse sind die Quelle […] der Unterhaltungen“. Johann Wolfgang Goethes „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“ und die Poetik des performativen Selbstwiderspruchs | 111 | ||
| WOLFGANG BUNZEL: Die unendliche Geschichte. Clemens Brentanos Märchenzyklen | 127 | ||
| TORSTEN HOFFMANN: Reibungswärme. Entgrenzungsstrategien in Heinrich von Kleists Rahmenzyklus „Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten“ | 155 | ||
| STEFAN SCHERER: Der Rahmenzyklus als romantisches Universaldrama. Ludwig Tiecks „Phantasus“ | 177 | ||
| UWE JAPP: Die Reflexion der Erzählung. Entwurf und Durchführung der Rahmenhandlung in E.T.A. Hoffmanns „Die Serapions-Brüder“ | 199 | ||
| CHRISTINE MIELKE: Scheherazade auf der Couch. Heinrich Heines Zyklus „Florentinische Nächte“ | 215 | ||
| STEPHANIE HECK / SIMON LANG: „So gut wie ein Roman“? Hans Scholz’ „Am grünen Strand der Spree“ | 233 | ||
| GABRIELE ROHOWSKI: „Wer B sagt, muß auch Occaccio sagen“. Robert Gernhardts „Florestan-Fragmente“ | 253 | ||
| CHRISTOPH KLEINSCHMIDT: Der Rahmenzyklus in den europäischen Literaturen. Von Boccaccio bis Goethe, von Chaucer bis Gernhardt. Nachwort | 279 | ||
| Tabellarische Auswertung der Rahmenzyklen | 291 | ||
| Auswahlbibliographie | 299 | ||
| Verzeichnis der Autorinnen und Autoren | 307 | ||
| Rückumschlag | 312 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish