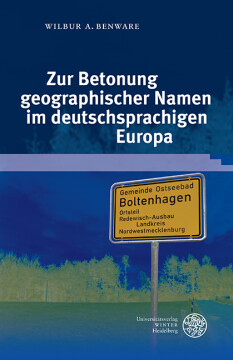
BUCH
Zur Betonung geographischer Namen im deutschsprachigen Europa
Germanistische Bibliothek, Bd. 57
2015
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Im vorliegenden Band ist die Betonung von mehr als 24 000 geographischen Namen im deutschsprachigen Raum aufgezeichnet. Dabei werden diachronische wie auch synchronische Bezugspunkte berücksichtigt, um die heutigen Betonungsverhältnisse zu erläutern. Das Werk dient einerseits als Nachschlagewerk, andererseits stellt es die Regelmäßigkeiten bei der vergangenen wie auch bei der heutigen Namensbildung dar. Der Hauptteil befasst sich mit den Topofixen bzw. unterscheidenden Zusätzen, die betont und auch unbetont vorkommen. Anschließend sind die verschiedenen Vorgänge zusammengefasst, die zur gegenwärtigen Betonungslage beigetragen haben.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 3 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Abkürzungen | 11 | ||
| Abkürzungen zur zitierten Literatur | 13 | ||
| 1 Einleitung | 15 | ||
| 1.1 Die Forschungslage | 15 | ||
| 1.2 Zielsetzung und Umfang | 16 | ||
| 1.3 Begriffsbestimmug | 19 | ||
| 1.3.1 Gereihte und gefügte Bildungsweisen | 19 | ||
| 1.3.2 Das Topofix | 20 | ||
| 1.3.3 Das Bestimmungswort (BW) | 21 | ||
| 1.4 Unbetonte Topofixe | 22 | ||
| 1.5 Derivationssuffixe | 23 | ||
| 1.6 Erklärung | 23 | ||
| 2 Die Quellen zur Toponymenbetonung | 25 | ||
| 2.1 Bestandsaufnahme der Quellen | 25 | ||
| 2.1.1 Duden. Die Rechtschreibung der geographischen Namen Deutschlands | 25 | ||
| 2.1.2 Duden. Aussprachewörterbuch (19742, 20056) | 25 | ||
| 2.1.3 Geonames Data Bank (GNDB) | 26 | ||
| 2.1.4 Das Geodatenzentrum (GDZ) | 26 | ||
| 2.1.5 Das Geographische Namenbuch Österreichs (GN) | 26 | ||
| 2.1.6 A Swiss Pronouncing Gazeteer (Populated Places) | 26 | ||
| 2.1.7 Kreisnamensammlungen | 27 | ||
| 2.1.8 Bildungsweise und Betonung der deutschen Ortsnamen (1959/19772) | 28 | ||
| 2.2 Auswertung der Quellen | 28 | ||
| 2.2.1 Zahlenangaben | 30 | ||
| 2.2.2 Überschneidungen bei der Quellenauswertung | 31 | ||
| 2.3 Varianten | 32 | ||
| 2.3.1 Betonungsvarianten | 32 | ||
| 2.3.2 Schreibvarianten | 33 | ||
| 2.3.3 Namengebungsvarianten | 33 | ||
| 2.4 Die Betonung bei dem Problem Mundart-Hochsprache | 33 | ||
| 3 Der Aufbau der Einträge | 35 | ||
| 3.1 Der Aufbau der Namenslisten | 35 | ||
| 3.2 Der Aufbau der einzelnen Namen | 35 | ||
| 4 Toponyme mit Endbetonung | 39 | ||
| 4.1 Einleitung | 39 | ||
| 4.2 Toponyme mit endbetonten Topofixen | 40 | ||
| 5 Die -bach- und -berg-Namen | 253 | ||
| 5.1 Geographische Namen auf -bach | 253 | ||
| 5.2 Geographische Namen auf -berg | 264 | ||
| 5.3 Geographische Namen auf -berge(-n)/-berga | 282 | ||
| 6 Zusätze | 285 | ||
| 6.1 Einleitung | 285 | ||
| 6.2 Vorgestellte Zusätze | 285 | ||
| 6.2.1 Adjektivische, adverbiale und präpositionale (AAP) vorgestellte unterscheidende Zusätze | 285 | ||
| 6.2.1.1 Alt | 289 | ||
| 6.2.1.2 Außer | 292 | ||
| 6.2.1.3 Dorn | 293 | ||
| 6.2.1.4 Groβ | 294 | ||
| 6.2.1.5 Hinter | 297 | ||
| 6.2.1.6 Hoch | 299 | ||
| 6.2.1.7 Hoh | 301 | ||
| 6.2.1.8 Inner | 304 | ||
| 6.2.1.9 Klein | 305 | ||
| 6.2.1.10 Lang | 308 | ||
| 6.2.1.11 Mittel | 310 | ||
| 6.2.1.12 Neu | 312 | ||
| 6.2.1.13 Nieder | 317 | ||
| 6.2.1.14 Ober | 321 | ||
| 6.2.1.15 Über | 328 | ||
| 6.2.1.16 Unter | 329 | ||
| 6.2.1.17 Vor | 332 | ||
| 6.2.1.18 Vorder | 333 | ||
| 6.2.1.19 Wenig | 334 | ||
| 6.2.2 Vorgestellte unterscheidende Zusätze bei Länder-, Fluss- u. Gebietsnamen | 335 | ||
| 6.2.3 Eine Volksbezeichnung als vorgestellter unterscheidender Zusatz | 335 | ||
| 6.2.4 Ein Farbenname als vorgestellter unterscheidender Zusatz | 336 | ||
| 6.2.5 Ein Gewässername als vorgestellter Zusatz (Z) | 336 | ||
| 6.2.6 Andere Namen mit vorgestelltem Zusatz | 338 | ||
| 6.2.6.1 Zusätze mit kategorieller Bedeutung | 338 | ||
| 6.2.6.2 Zweigliedrige Zusätze | 346 | ||
| 6.2.6.3 Sonstige vorgestellte Zusätze | 347 | ||
| 6.2.7 Zusammenfassung: Vorgestellte Zusätze | 349 | ||
| 6.3 Nachgestellte Zusätze | 350 | ||
| 6.3.1 Eine Präpositionalphrase als nachgestellter unterscheidender Zusatz | 350 | ||
| 6.3.2 Ein Substantiv als nachgestellter Zusatz | 351 | ||
| 6.3.2.1 Zweigliedrige GNn + betonter Zusatz | 351 | ||
| 6.3.2.2 Ein einfaches Propriativ + Zusatz | 352 | ||
| 6.4 Nachtrag: AB-Komposita mit Endbetonung | 353 | ||
| 7 Unika und andere mehrsilbige Namen | 355 | ||
| 7.1 Einleitung | 355 | ||
| 7.2 Mehrsilbige Unika romanischen Ursprungs | 355 | ||
| 7.3 Mehrsilbige Unika slawischen Ursprungs | 356 | ||
| 7.4 Sonstige mehrsilbige Unika mit Endbetonung | 357 | ||
| 7.5 Mundartbelege | 359 | ||
| 7.6 Ein Propriativum als Grundwort mit Endbetonung | 370 | ||
| 7.6.1 Ortsnamen mit einem Gewässernamen als Grundwort | 370 | ||
| 7.6.2 Zweigliedrige Namen mit einem Siedlungs- bzw. Ländernamen als GW | 371 | ||
| 7.7 Geographische Namen, die einen Personen- bzw. Familiennamen enthalten | 372 | ||
| 7.8 Dreigliedrige Zusammensetzungen (‚Dekomposita‘) | 375 | ||
| 7.9 Viergliedrige Zusammensetzungen | 377 | ||
| 7.10 Fertige Appellativa | 378 | ||
| 8 Regelmäßigkeiten bei der Namensbildung der Gegenwartssprache | 379 | ||
| 8.1 Einleitung | 379 | ||
| 8.2 Kopulativkomposita | 379 | ||
| 8.2.1 Stadtteilnamen | 380 | ||
| 8.2.2 Zwei gleichrangige geographische Namen | 380 | ||
| 8.2.3 Kopulative Namensbildung mit ‚und‘ | 381 | ||
| 8.2.4 Andere Bindestrich-Namen | 381 | ||
| 8.3 Phrasennamen | 381 | ||
| 8.3.1 Eine Präpositionalphrase als geographischer Name | 382 | ||
| 8.3.2 Eine Nominalphrase als geographischer Name | 383 | ||
| 8.3.2.1 Nominalphrasen: Adjektiv + Substantiv/Kompositum | 383 | ||
| 8.3.2.2 Eine Größe + ein Appellativ | 385 | ||
| 8.3.2.3 Geographische Namen mit Genitiv-Nominalphrase | 385 | ||
| 8.3.2.4 Ortsnamen + eine Ziffer | 386 | ||
| 8.4 Die aus einem Ableitungsprozess entstandenen Namen | 386 | ||
| 8.4.1 Geographische Namen mit dem Bestimmungselement auf <-ER> | 386 | ||
| 8.4.1.1 Betonung auf dem Endelement | 387 | ||
| 8.4.1.2 Betonung auf dem Bestimmungselement | 388 | ||
| 8.4.1.3 Mundartbelege | 388 | ||
| 8.4.2 Geographische Namen mit dem Bestimmungselement auf <–SCH> | 390 | ||
| 8.5 Satzartige Namen | 391 | ||
| 8.6 Personennamen in/als Ortsnamen | 391 | ||
| 8.6.1 Allgemeines | 391 | ||
| 8.6.2 Maria als Erstglied eines Ortsnamens | 392 | ||
| 8.6.3 Heiligennamen ohne nachgestellten Zusatz | 392 | ||
| 8.6.4 Andere mit einem Personennamen gebildete Ortsnamen | 392 | ||
| 9 Erklärungen der Betonungsverhältnisse: Zusammenfassung | 395 | ||
| 9.1 Einleitung | 395 | ||
| 9.2 Die vier Hauptvorgänge | 395 | ||
| 9.2.1 Das Ergebnis eines syntaktischen Gefüges (gefügte Bildung) | 395 | ||
| 9.2.2 Zusammensetzungen | 397 | ||
| 9.2.3 Analogische Umbildung | 397 | ||
| 9.2.4 Zusätze | 398 | ||
| 9.3 Endbetonung über eine Derivation | 400 | ||
| 9.4 Betonte slawische Suffixe | 400 | ||
| 9.5 Namen aus einer romanischen Sprache | 401 | ||
| 9.6 Klammerformen | 401 | ||
| 9.7 Ersatz eines unbetonten Topofixes | 401 | ||
| 9.8 Umdeutungen | 402 | ||
| 10 Ausblick | 403 | ||
| Literatur | 405 | ||
| Internetquellen | 421 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish