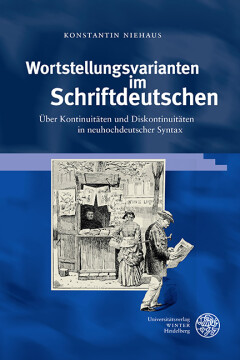
BUCH
Wortstellungsvarianten im Schriftdeutschen
Über Kontinuitäten und Diskontinuitäten in neuhochdeutscher Syntax
Germanistische Bibliothek, Bd. 58
2016
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Die Wortstellung im Schriftdeutschen gilt heutzutage als vergleichsweise strikt geregelt und variationsarm. Aber über wie viel Variation hat sie einst verfügt und verfügt sie noch? Welche konkreten Varianten waren und sind dabei in Gebrauch und was macht diese ‚typisch‘ schriftdeutsch? Und inwieweit lässt sich dabei ein Variantenabbau nachverfolgen gegenüber einer stabilen (Nicht-)Variation? Diese Arbeit behandelt genau solche Fragen. Erstmals bilden Zeitungstexte die Quellenbasis, und wo immer möglich bietet die Analyse einen Vergleich mit weiteren Varietäten. So wird die historische Variationsbreite dreier syntaktischer Phänomene bis in die Gegenwart sichtbar: Serialisierung in Verbalkomplexen, Ausklammerung und Genitivattribut werden untersucht. Dabei offenbart sich ein ungeahntes Potenzial von Kontinuitätsdeutungen ebenso wie das Problem, mit gängigen Grammatikmodellen die Variation des tatsächlichen Sprachgebrauchs nicht immer adäquat zu erfassen.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | C | ||
| Titel | III | ||
| Impressum | IV | ||
| Inhalt | V | ||
| Vorwort | IX | ||
| Abkürzungsverzeichnis | X | ||
| A. Einführung | 1 | ||
| 1. Motivation: Kontinuität im Neuhochdeutschen | 1 | ||
| 2. Aufbau und Vorgehensweise: Wahl der Varianten und Korpora | 2 | ||
| 3. Zielsetzung: Gebrauchsgeschichte der schriftdeutschen Syntax | 4 | ||
| B. Theorie | 7 | ||
| 1. Konzept der ‚historischen Angemessenheit | 7 | ||
| 1.1 Entwicklung: Kontinuität und Wandel/Diskontinuität | 7 | ||
| 1.2 Kontinuität und Sprachwandel | 10 | ||
| 1.3 Schriftsprache als Grundlage historischer Grammatikforschung | 13 | ||
| 1.4 Viabilität und Gegenwartsbezug | 18 | ||
| 2. Zeitungen als Quellen | 19 | ||
| 2.1 Zeitungssprache als Schriftsprache | 19 | ||
| 2.2 ‚Zeitungssyntax | 22 | ||
| 2.3 Historische Merkmale der Zeitung | 23 | ||
| 2.4 Soziologie der Schreiber | 26 | ||
| 2.5 Theoretische Problemfälle: Textsorten, regionale Stile, Areallinguistik | 30 | ||
| C. Methode | 33 | ||
| 1. Vorgehensweise | 33 | ||
| 1.1 Fragen der Automatisierung, Quantifizierung und ‚Plausibilität‘ | 33 | ||
| 1.2 Grafische Darstellungen | 37 | ||
| 2. Korpusdesign | 38 | ||
| 2.1 Repräsentativität vs. Brauchbarkeit | 38 | ||
| 2.2 Ausgewogenheit und weitere Quellenauswahl | 39 | ||
| 3. Korpora | 42 | ||
| 3.1 Schnellübersicht | 42 | ||
| 3.2 GerManC-Zeitungen (1701–1800) | 42 | ||
| 3.3 Industrialisierungskorpus (1800–1870) | 43 | ||
| 3.4 erweitertes Kaiserreichkorpus (1871–1918) | 44 | ||
| 3.5 Gegenwartskorpus (2010–2013) | 45 | ||
| D. Finitum im Verbalkomplex | 47 | ||
| 1. Forschungsüberblick | 47 | ||
| 1.1 Ober-/Unterfeld und grundlegende Stellungsvarianten | 48 | ||
| 1.2 Kurzer Abriss zur Entwicklung der Serialisierung | 50 | ||
| 1.3 Historische Prinzipien der Serialisierung | 53 | ||
| 1.4 Komplexitäts- und Auxiliarfaktor | 54 | ||
| 1.5 Erklärungsansätze | 56 | ||
| 1.5.1 ‚Doppelter Infinitiv‘ und Ersatzinfinitiv | 56 | ||
| 1.5.2 ‚Tonwechsel‘ und Fokus | 58 | ||
| 1.6 Darstellung in den Gegenwartsgrammatiken | 60 | ||
| 2. Analyse drei- und mehrgliedriger Verbalkomplexe in Nebensätzen | 62 | ||
| 2.1 Generelles zur Entwicklung der Stellungsvarianten | 62 | ||
| 2.2 Äquivalenzprinzip und Komplexitätsfaktor | 67 | ||
| 2.2.1 Zweigliedrige und dreigliedrige VKs | 67 | ||
| 2.2.2 Dreigliedrige und mehrgliedrige VKs | 68 | ||
| 2.2.3 Fazit | 71 | ||
| 2.3 R-d-l-Prinzip . fixes Prinzip des Schriftdeutschen | 72 | ||
| 2.4 Nachstellungsprinzip und Auxiliarfaktor: Problem des ‚Normalfalls‘ | 73 | ||
| 2.4.1 Entwicklung einzelner VK-Typen | 75 | ||
| 2.4.1.1 Typen I bis III | 75 | ||
| 2.4.1.2 Typen IV, Va und VIIIa | 83 | ||
| 2.4.2 Fazit zum Nachstellungsprinzip und Auxiliarfaktor | 91 | ||
| 2.5 Zur Erklärung der Serialisierung über den Ersatzinfinitiv | 93 | ||
| 2.6 Zu weiteren möglichen grammatischen Faktoren | 95 | ||
| 2.7 Feldertheorie als Problem: das erweiterte Unterfeld | 96 | ||
| 2.7.1 Bindungsfreudigkeit syntaktisch und lexikalisch-semantisch | 96 | ||
| 2.7.2 Zwischengestellte Finita und ‚Z-Position‘ | 100 | ||
| 3. Zusammenfassung: ‚Prinzipien‘ vs. ‚Faktoren | 105 | ||
| E. Ausklammerungsformen | 109 | ||
| 1. Definition | 109 | ||
| 1.1 Abgrenzung zu ‚Herausstellungen | 110 | ||
| 1.2 Grammatikalisierungsfrage und Arbeitsdefinition | 113 | ||
| 1.3 Vorüberlegungen zur Methodik | 115 | ||
| 2. Forschungsüberblick | 117 | ||
| 2.1 Problematik des Vergleichs mit früheren Studien | 117 | ||
| 2.2 Entwicklung der Ausklammerung | 122 | ||
| 2.3 Erklärungsansätze | 124 | ||
| 2.3.1 Richtungs- und Resultativ-Semantik bei Präpositionalphrasen | 124 | ||
| 2.3.2 Analogiebildung bei Vergleichskonstruktionen | 125 | ||
| 2.3.3 Natürlichkeit als Kriterium | 126 | ||
| 2.3.4 ‚Schwere‘ des Wortmaterials | 127 | ||
| 2.4 Darstellung in den Gegenwartsgrammatiken | 129 | ||
| 3. Analyse der Ausklammerungsformen | 132 | ||
| 3.1 Übergeordnete Entwicklungen | 132 | ||
| 3.1.1 Zur Frage der Grammatikalisierung | 132 | ||
| 3.1.2 Syntaktische Formen | 138 | ||
| 3.1.3 Syntaktische Funktionen | 144 | ||
| 3.1.4 Fazit: erste modifizierte Einteilung der Ausklammerungsformen | 146 | ||
| 3.2 Satzförmige Ausklammerungen | 147 | ||
| 3.2.1 NF-Besetzung wegen satzinterner Temporalität | 149 | ||
| 3.2.2 Restriktive vs. appositive Relativsätze | 150 | ||
| 3.3 Phrasenförmige Ausklammerungen | 151 | ||
| 3.3.1 Nominalphrasen | 151 | ||
| 3.3.1.1 Zeittypischer Stil des 19. Jhs | 152 | ||
| 3.3.1.2 ‚Leichte‘ Nominalphrasen | 153 | ||
| 3.3.2 Konjunktionalphrasen (Vergleichskonstruktionen | 155 | ||
| 3.3.2.1 Lexemsteuerung und Art der Klammer | 156 | ||
| 3.3.2.2 Stellungsvariation und syntaxfunktionelle Unterscheidung | 157 | ||
| 3.3.3 Präpositionalphrasen | 159 | ||
| 3.3.3.1 Quantitative Entwicklung | 160 | ||
| 3.3.3.2 Lexikalisch-statusformale Rektion und VF-Fähigkeit | 164 | ||
| 3.3.3.3 Direktive Ausklammerungen | 167 | ||
| 3.3.3.4 Arealität | 169 | ||
| 3.4 Zur (stilisierten) Nähesprachlichkeit und Natürlichkeit | 170 | ||
| 3.5 Adjunktklammer, Prädikatsklammer und andere Zweifelsfälle | 173 | ||
| 4. Zusammenfassung: empirische Mängel und theoretische Desiderate | 176 | ||
| F. Wortstellung des Genitivattributs | 179 | ||
| 1. Forschungsüberblick | 179 | ||
| 1.1 Entwicklung der Stellungsvariation | 180 | ||
| 1.2 Stilistik | 181 | ||
| 1.3 Erklärungsansätze | 183 | ||
| 1.3.1 Sprachtypologisches: Nachstellung und Belebtheit | 183 | ||
| 1.3.2 Systemlinguistisches: ‚Genitivregel‘ und Genitivschwund | 183 | ||
| 1.3.3 Wandel pränominaler Genitivattribute zum Quasi-Artikel | 184 | ||
| 1.3.4 Wechsel des Merkmals Definitheit/Indefinitheit | 185 | ||
| 1.3.5 Postnominale Stellung aufgrund zusätzlicher Attribuierungen | 186 | ||
| 1.4 Darstellung in den Gegenwartsgrammatiken | 186 | ||
| 2. Analyse der Wortstellung des Genitivattributs | 189 | ||
| 2.1 Entwicklung der Stellungsvariation | 190 | ||
| 2.2 Distanzstellungen und Zwischenstellungen | 193 | ||
| 2.3 EN vs. NN als Genitivattribut | 196 | ||
| 2.4 Semantik | 201 | ||
| 2.4.1 Semantik der Eigennamen | 201 | ||
| 2.4.2 Semantische Genitivklassen: Genitivus partitivus | 204 | ||
| 2.5 Morphosyntax und Markiertheitsverhältnisse | 207 | ||
| 2.5.1 Artikelgebrauch, Definitheit, Bekanntheit | 207 | ||
| 2.5.2 Flexion und Apostrophe | 212 | ||
| 2.6 Komplexität | 213 | ||
| 2.6.1 Attribuierungen des Kernnomens | 213 | ||
| 2.6.2 Attribuierungen von Genitivattributen | 215 | ||
| 2.6.3 Genitivketten | 219 | ||
| 2.7 Konventionalisierung als Faktor | 220 | ||
| 3. Zusammenfassung: Wortstellungsstabilität und Viabilität | 221 | ||
| G. Ergebnisse | 223 | ||
| 1. Kurze Anmerkungen zur ‚Standardisierung‘ und zur Zeitungssprache | 223 | ||
| 2. Skriptizistische Grammatiktheorien und Kontinuität | 223 | ||
| 3. Grammatikografischer Nutzen der Sprachgebrauchsgeschichte | 227 | ||
| 4. Grenzen der Untersuchung und Kritik | 230 | ||
| 5. Ausblick | 232 | ||
| Quellen | 235 | ||
| 1. GerManC-Zeitungen 1701–1750 | 235 | ||
| 2. GerManC-Zeitungen 1751–1800 | 236 | ||
| 3. Industrialisierungskorpus 1800–1870 | 237 | ||
| 4. erweitertes Kaiserreichkorpus 1871–1918 | 239 | ||
| 5. Gegenwartskorpus (2010–2013) | 241 | ||
| 6. Korpusgrößen | 243 | ||
| 7. weitere Quellen | 246 | ||
| Literaturverzeichnis | 247 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish