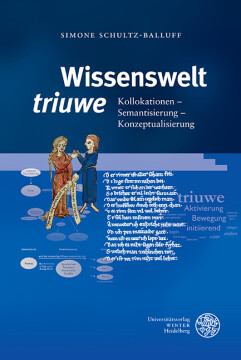
BUCH
Wissenswelt ‚triuwe‘
Kollokationen – Semantisierung – Konzeptualiserung
Germanistische Bibliothek, Bd. 59
2018
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Treue gilt ungebrochen als wichtigster ethischer Faktor und grundlegendes gesellschaftkonstituierendes Element des Mittelalters. Die vorliegende textsortenübergreifende Studie geht erstmals der Konzeptualisierung von Treue in deutschsprachigen Texten des Mittelalters auf breiter Materialbasis nach. Knapp 800 Belegstellen aus Prosa- und Verstexten aller Themenbereiche (Poesie, Religion, Geschichte, Recht u.a.m.) von den Anfängen volkssprachiger Schriftlichkeit bis um 1350 bilden die Grundlage. Die Auswertung und Analyse erfolgt konsequent lexembezogen und ausgehend von den Verwendungsweisen von mhd. ‚triuwe‘, ahd. ‚triuwa‘ und as. ‚treuwa‘ nebst der mit ‚un‘- präfigierten Formen. Hierfür werden die diskurslinguistische Mehr-Ebenen-Analyse und die Frame-Semantik auf die historische Textsituation angepasst und hinsichtlich der Handhabung und Visualisierung größerer Belegmengen erprobt. Die Studie versteht sich als Plädoyer für das Zusammengehen von sprachlichen und literaturwissenschaftlichen Ansätzen, wenn es darum geht, historische Wissensbereiche zu erfassen und zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | Cover | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| I Einleitung | 11 | ||
| 1 Sprache – Literatur – Kultur | 11 | ||
| 2 Historische Konzepte und Wissensstrukturen | 14 | ||
| 3 Die Verknüpfung von historischer Semantik und Literaturwissenschaft als Herausforderung?! | 15 | ||
| 4 Das Wissen über ‚Treue‘ in deutschen Texten des Mittelalters | 17 | ||
| 5 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit | 20 | ||
| 6 Allgemeine Vorbemerkungen und editorische Anmerkungen | 21 | ||
| 6.1 Wiedergabe der handschriftlichen Form und Nachweis der Textstelle | 21 | ||
| 6.2 Formung des abstrakten Wortlauts | 22 | ||
| 6.3 Hervorhebungen | 22 | ||
| II Sprache und Literatur im Spannungsfeld von historischer Semantik, kognitiver Linguistik und mediävistischer Literaturwissenschaft | 23 | ||
| 1 Historische Semantik als ‚Arbeit am Wort‘ – Ausgangspunkte | 23 | ||
| 1.1 Gegenwärtige Positionierung der historischen Semantik als Wissenschaftsrichtung | 25 | ||
| 1.1.1 Wortbedeutung und Begriffsgeschichte | 26 | ||
| 1.1.2 Die Fokussierung auf den Wandel von Bedeutungen | 27 | ||
| 1.1.3 Herkömmliche Verfahren zur Beschreibung und Bewertung | 29 | ||
| 1.1.4 Datenbasis | 30 | ||
| 1.2 Wissenschaftsgeschichtlicher Abriss zur historischen Semantik | 30 | ||
| 1.2.1 Sprache, Geist und die Idee vom Sprachwandel – Anfänge und Entwicklungen im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert | 31 | ||
| 1.2.2 Strukturalismus, generative Sprachauffassung und kognitive Wende – neue Chancen für eine historische Semantik?! | 37 | ||
| 1.2.3 Handlungstheoretische Semantik, linguistische Diskursanalyse und Wissensrahmen | 44 | ||
| 1.3 Profilbildung: Neue Wege einer historischen Semantik | 47 | ||
| 2 Spracharbeit und literarisches Schaffen: Die Relevanz semantischer Analysen für die germanistische Mediävistik | 49 | ||
| 2.1 Wort- und Begriffsgeschichte in Literaturwissenschaft und historischer Linguistik | 50 | ||
| 2.2 Neuere Ansätze der historischen Semantik in der germanistischen Mediävistik | 56 | ||
| 2.3 Möglichkeiten einer praktischen Annäherung: Spracharbeit und literarisches Schaffen | 58 | ||
| 3 Wissenswelten | 62 | ||
| 3.1 Speicherung, Transformation und Manifestation von Wissen | 63 | ||
| 3.2 Wissensbereiche | 65 | ||
| 3.3 Extraktion von Wissen | 67 | ||
| 3.4 Analyse von Wissensstrukturen: Diskurs und Wissensrahmen | 68 | ||
| 4 Auswählen und Aufbereiten: Digital verfügbares Textmaterial und historisch semantische Fragestellungen | 70 | ||
| 4.1 Verfügbare Korpora, Textsammlungen und Gesamtüberlieferungen | 71 | ||
| 4.2 Das Design der Referenzkorpora zum Altdeutschen und Mittelhochdeutschen | 73 | ||
| 4.3 Die kommunikative Verortung von Texten und Textstellen | 76 | ||
| 4.3.1 Klassifizierung von Texten: Bezugswelten, Texttypen und Textfunktionen | 78 | ||
| 4.3.2 Klassifizierung von Textstellen: Themen, Duktus und Sprechakte | 82 | ||
| 5 Sammeln und Auswerten: Diskursanalytische Möglichkeiten | 84 | ||
| 5.1 Kategorien von ‚Treue‘: Konzept, Begriff und Diskurs | 85 | ||
| 5.2 triuwa/ treuwa/ triuwe – Gebrauch, Verwendungsweisen und Bedeutung | 90 | ||
| 5.3 Kontexttypen und Referenzbereiche | 94 | ||
| 5.4 Der Versuch: Germanistisch-mediävistische Diskursanalyse auf mehreren Ebenen | 96 | ||
| 6 Ordnen und Sichtbarmachen: Frame-Semantik | 108 | ||
| 6.1 Frames als Wissensspeicher | 109 | ||
| 6.2 Rahmenanalyse und Visualisierung | 111 | ||
| 6.2.1 Frame-Elemente zwischen konkret und abstrakt | 112 | ||
| 6.2.2 Generierte Frames: Erstellung, Intention und Leserichtung | 117 | ||
| 6.2.3 Frame-Beziehungen: Granularität, Makroframe und Subframe, Frame-Netzwerk | 122 | ||
| 6.3 Einsatzbereiche und Nutzen frame-semantischer Analysen | 128 | ||
| III Etymologie, Bedeutungsbereiche und Wortfamilie | 131 | ||
| 1 Anmerkungen zur Etymologie | 131 | ||
| 2 Anmerkungen zu den Bedeutungsbereichen | 133 | ||
| 3 Deutsche und lateinische Lexeme für ‚Treue‘ | 135 | ||
| 4 Die Wortfamilie: Zum Stellenwert von Derivaten und Komposita | 137 | ||
| 5 Das graphische Erscheinungsbild | 139 | ||
| IV Verwendungsweisen von "triuwe" und diskursive Formationen von ‚Treue‘ in deutschsprachigen Texten von den Anfängen bis 1350 | 141 | ||
| 1 Theoretische, methodische und empirische Ausgangspunkte | 141 | ||
| 2 Korrespondenzen im weiteren semantischen Umfeld: Schlüsselwörter, Geltungsbereiche und Themenfelder | 147 | ||
| 2.1 Aufzählungen als Basis für die Ableitung von Geltungsbereichen | 148 | ||
| 2.2 Themenfelder und ihre sprachliche Realisation über Schlüsselwörter | 155 | ||
| 2.3 Zusammenfassung | 158 | ||
| 3 Lexikalische Solidaritäten und Kollokationen – das engere semantische Umfeld | 159 | ||
| 3.1 "triuwe" und "untriuwe" in Präpositionalphrasen | 161 | ||
| 3.1.1 "si klagten in mit triuwen" – Phrasen mit den Präpositionen "mit" und "ane" | 163 | ||
| 3.1.2 "daz wiſzit vf die druwe min" – Phrasen mit den Präpositionen "bî" und "ûf" | 166 | ||
| 3.1.3 "thurh iro treuua gôda" – Phrasen mit den Präpositionen "in" und "durch" | 168 | ||
| 3.1.4 "Din hertze von triwen iſt erieten" – Phrasen mit der Präposition "von" | 170 | ||
| 3.1.5 "si lif zu diner truen" – Phrasen mit der Präposition "ze" | 172 | ||
| 3.1.6 "uor intriwen nemac ſich niemen bewarn" – Phrasen mit den Präpositionen "umbe" und "vor" | 173 | ||
| 3.1.7 Zusammenfassung | 174 | ||
| 3.2 "triuwe" und "untriuwe" im Objektgebrauch | 179 | ||
| 3.2.1 "Mînemo trûte léist ih trûiuua – triuwe" als Patiens | 179 | ||
| 3.2.2 "Sin alde truwe in rurte – triuwe" als Agens | 185 | ||
| 3.2.3 Zusammenfassung | 188 | ||
| 3.3 Direkte und indirekte Modifikation von "triuwe" und "untriuwe" | 190 | ||
| 3.3.1 "nu scolt du mich erhoren durch die waren triwe" – direkte Modifikation | 190 | ||
| 3.3.2 "du solt in holt mit trǐwen sin" – indirekte Modifikation | 193 | ||
| 4 Formulierungsroutinen | 196 | ||
| 4.1 Zweiwortverbindungen und formelhafte Wendungen | 198 | ||
| 4.1.1 Zweiwortverbindungen | 198 | ||
| 4.1.2 Bekräftigung – Betonung – Beteuerung: "triuwe" in Routineformeln | 208 | ||
| 4.1.3 Formelhafte Wendungen mit referentiellem Charakter | 213 | ||
| 4.2 Formulierungsroutinen in Rechtstexten | 215 | ||
| 4.2.1 Urkunden | 216 | ||
| 4.2.2 Rechts- und Stadtbücher sowie die "Schwäbische Trauformel" | 224 | ||
| 4.3 Rechtsrelevante Formulierungsroutinen in diskursiver Perspektive | 233 | ||
| 5 Sprachliche Bilder | 241 | ||
| 5.1 Ausgangsbereich: Natur | 243 | ||
| 5.2 Ausgangsbereiche: Sinne, Emotion und Kognition | 245 | ||
| 5.3 Ausgangsbereiche: Gegenstände und Materialität | 249 | ||
| 5.4 Ausgangsbereiche: Handlungen und Geschick | 253 | ||
| 5.5 Ausgangsbereiche: Personen und personale Bindungen | 257 | ||
| 5.6 Zusammenfassung | 259 | ||
| 6 Das Konzept von "untriuwe" | 261 | ||
| 6.1 "untriuwe" als Vergehen, Sünde und Todsünde | 262 | ||
| 6.2 "untriuwe" in Herrschaft, Gesellschaft und Familie | 265 | ||
| 6.3 "untriuwe" als Zustand der Aussichtslosigkeit | 267 | ||
| 6.4 Wege aus der "untriuwe" | 270 | ||
| 6.5 Richtungweisend: keine "triuwe" als Hinweis auf "untriuwe" | 270 | ||
| 6.6 Auswege und Perspektiven: das Fehlen von "untriuwe" | 272 | ||
| 6.7 Zusammenfassung | 276 | ||
| 7 Der situative Rahmen von Treueverhältnissen | 277 | ||
| 7.1 "So bind ich mich mit minen triwen vnder mins Vaters Inſigel" – Konstituierung und Beginn von Treueverhältnissen | 279 | ||
| 7.2 nv tv̊t mir ǐwer triwe ſchin – optimale Durchführung von Treueverhältnissen | 284 | ||
| 7.3 "ur true is kleine gnůch da bi" – Treueverhältnisse in der Krise | 290 | ||
| 7.4 "In then truwen er in verriet" – der Bruch von Treueverhältnissen | 296 | ||
| 7.5 "Da uerſagt im die fraw ir trew mit ſmehigen worten" – das Ende von Treueverhältnissen | 301 | ||
| 7.6 Zusammenfassung | 304 | ||
| 8 Akteure und personelle Konstellationen | 305 | ||
| 8.1 Herrschaftliche Treueverbindungen | 305 | ||
| 8.2 Genossenschaftliche Treueverbindungen | 310 | ||
| 8.3 Treueverbindungen zwischen Mann und Frau | 315 | ||
| 8.4 Treuebindungen zwischen Eltern und Kind | 321 | ||
| 8.5 Der Mensch und spirituelle Instanzen | 326 | ||
| 8.5.1 Der Mensch und Gott | 327 | ||
| 8.5.2 Der Mensch und Jesus Christus | 329 | ||
| 8.5.3 Der Mensch und Maria | 331 | ||
| 8.5.4 Mensch, Gott und Teufel | 333 | ||
| 8.6 Individuum und abstrakte Instanz | 335 | ||
| 8.7 Zusammenfassung | 338 | ||
| 9 Semantisierungsrichtungen und Semantiken von "(un)triuwe" | 339 | ||
| V Perspektiven auf Literatur | 345 | ||
| 1 "triuwe" und ‚Treue‘ als literarhistorisches Untersuchungsfeld | 347 | ||
| 2 Vergleichsgrößen und Inspirationsquellen: Wissensrahmen | 353 | ||
| 2.1 Verwendungsweisen von "triuwe" und "untriuwe": Werkprofile | 354 | ||
| 2.2 Verwendungsweisen von "triuwe" in Wolframs von Eschenbach "Parzival" | 360 | ||
| 2.3 Perspektiven | 363 | ||
| VI Synergien, Grenzen und neue Wege einer historischen Semantik | 365 | ||
| 1 Synergetisierung | 366 | ||
| 2 Korpusarbeit und Grenzen | 366 | ||
| 3 Wissensrahmen und Anschlussfähigkeit | 367 | ||
| 4 Perspektiven und Desiderata | 367 | ||
| 5 Kollokationen und Diachronie | 368 | ||
| 6 Semantisierung und Konzeptualisierung | 369 | ||
| VII Anhang | 371 | ||
| 1 Verzeichnis der Primärquellen | 371 | ||
| 2 Literaturverzeichnis | 394 | ||
| 3 Zeiträume und Belegzahlen für triuwe und untriuwe | 415 | ||
| 4 Belegstellen von "triuwe" und "untriuwe" | 420 | ||
| 5 Verzeichnis der Abbildungen | 432 | ||
| Backcover | 435 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish