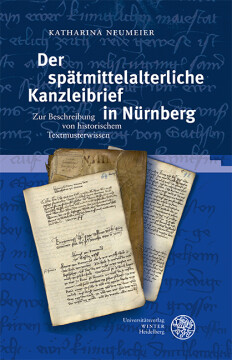
BUCH
Der spätmittelalterliche Kanzleibrief in Nürnberg
Zur Beschreibung von historischem Textmusterwissen
Germanistische Bibliothek, Bd. 84
2025
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Der Begriff ‚Textmusterwissen‘ bezeichnet in der linguistischen Forschung das Wissen über die typischen, mehr oder weniger stark verfestigten sprachlichen Muster einzelner Textsorten, auf das im Produktions- und Rezeptionsprozess zurückgegriffen wird. Katharina Neumeier entwickelt in ihrer Studie eine Methodik zur Untersuchung von Textmusterwissen historischer Texte. Sie führt textlinguistische, phraseologische und konstruktionsgrammatische Konzepte zu einem integrativen Beschreibungsansatz zusammen, den sie am spätmittelalterlichen Nürnberger Kanzleibrief erprobt. Im Fokus stehen dabei knapp 800 Briefe des Nürnberger Rates vom Beginn des 15. Jahrhunderts. In Gegenüberstellung mit den Lehren brieflicher Formelbücher sowie der Briefüberlieferung Speyers stellt sie die vielfältigen Aspekte des Kanzleibrief-Textmusters differenziert heraus. Die Studie ermöglicht so eine neue Sicht auf diese historische Kommunikationsform und die ihr eigene Formelhaftigkeit.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | III | ||
| Impressum | IV | ||
| Vorwort | V | ||
| Inhalt | VII | ||
| 1. (Kanzlei)Briefe als musterhafte Texte | 1 | ||
| 1.1 Forschungsstand | 2 | ||
| 1.2 Vorgehen und Ziel der Untersuchung | 5 | ||
| 1.3 Aufbau der Arbeit | 8 | ||
| 1.4 Wiedergabe der handschriftlichen Form und Nachweis von Textstellen | 9 | ||
| 2. Textliche Musterhaftigkeit als disziplinenübergreifendes Phänomen | 11 | ||
| 2.1 Textlinguistik | 12 | ||
| 2.1.1 Grundlagen | 12 | ||
| 2.1.2 Historische Textlinguistik | 15 | ||
| 2.2 Phraseologieforschung | 18 | ||
| 2.2.1 Grundlagen | 18 | ||
| 2.2.2 Historische Phraseologieforschung | 20 | ||
| 2.3 Konstruktionsgrammatik | 23 | ||
| 2.3.1 Grundlagen | 23 | ||
| 2.3.2 Historische Konstruktionsgrammatik | 28 | ||
| 2.4 Die Schnittstelle: Historisches Textmusterwissen | 30 | ||
| 3. Der historische und textliche Rahmen des spätmittelalterlichen Kanzleibriefs | 33 | ||
| 3.1 Der historische Kontext | 33 | ||
| 3.1.1 Die spätmittelalterliche Stadt als Zentrum der Kommunikation | 34 | ||
| 3.1.2 Die Kanzlei als institutioneller Ort der Textmusterentwicklung | 38 | ||
| 3.1.3 Nürnberg im Spätmittelalter | 41 | ||
| 3.1.3.1 Die Bedeutung der Reichsstadt | 42 | ||
| 3.1.3.2 Die städtischen Organisationsstrukturen | 43 | ||
| 3.1.3.3 Die Ratskanzlei und ihre Schreiber | 44 | ||
| 3.2 Die textliche Grundlage | 45 | ||
| 3.2.1 Der Kanzleibrief: Terminologische Präzisierung | 46 | ||
| 3.2.2 Primäre Briefüberlieferung: Die Nürnberger Briefbücher | 47 | ||
| 3.2.2.1 Entstehung, Nutzung und Gestaltung | 49 | ||
| 3.2.2.2 Zum Verhältnis von Briefbucheintragungen und Briefausfertigungen | 54 | ||
| 3.2.3 Sekundäre Briefüberlieferung: Formelsammlungen | 64 | ||
| 3.2.3.1 Historische Entwicklung und Nutzung | 65 | ||
| 3.2.3.2 Ausprägungen und Inhalte | 67 | ||
| 3.2.3.3 Formelsammlungen des 15. Jahrhunderts | 69 | ||
| 3.2.3.3.1 Das Formularbuch des Marquard Mendel | 69 | ||
| 3.2.3.3.2 Das Göttinger Formularbuch | 71 | ||
| 3.2.3.3.3 Das Formularbuch des Leonhardus Zweng | 73 | ||
| 3.2.3.3.4 Formulare und deutsch Rhetorica | 76 | ||
| 3.2.4 Das Untersuchungskorpus | 77 | ||
| 3.3 Zusammenfassung | 84 | ||
| 4. Formulierungsmuster im spätmittelalterlichen Kanzleibrief | 87 | ||
| 4.1 Identifizierung brieflicher Formulierungsmuster | 87 | ||
| 4.2 Beschreibung brieflicher Formulierungsmuster | 90 | ||
| 4.2.1 Adresse | 95 | ||
| 4.2.2 Grußformel | 102 | ||
| 4.2.3 Anredeformel | 106 | ||
| 4.2.4 Unterschrift bzw. Überschrift | 109 | ||
| 4.2.5 Kenntnisnahmeformel | 111 | ||
| 4.2.6 Narratioformel | 116 | ||
| 4.2.7 Dankesformel | 120 | ||
| 4.2.8 Bittformel | 124 | ||
| 4.2.9 SichdanachrichtenFormel | 132 | ||
| 4.2.10 Vertrauensformel | 135 | ||
| 4.2.11 Dienstformel | 140 | ||
| 4.2.12 Gegenseitigkeitsformel | 146 | ||
| 4.2.13 Antwortformel | 153 | ||
| 4.3 Zusammenfassung | 156 | ||
| 5. Wissensbestände und strukturen im spätmittelalterlichen Kanzleibrief | 159 | ||
| 5.1 Lexikalische Rekurrenz: Vernetzung durch Inhaltswörter | 160 | ||
| 5.1.1 Makroframe „Korrespondenzpartner“ | 162 | ||
| 5.1.2 Makroframe „Briefbezogene Handlungen“ | 177 | ||
| 5.2 Semantische Relationen: Vernetzung durch Konnektoren | 181 | ||
| 5.3 Koreferenzen: Vernetzung durch Pronomina | 183 | ||
| 5.3.1 PersonalundPossessivpronomina | 184 | ||
| 5.3.2 RelativundDemonstrativpronomina | 184 | ||
| 5.4 Strukturelle Wiederholungen und Auslassungen: Vernetzung durch Parallelismen und Ellipsen | 185 | ||
| 5.5 Tempus und Modus: Vernetzung durch Verbalkategorien | 187 | ||
| 5.5.1 Zeitliche Verortung | 187 | ||
| 5.5.2 Sozialhierarchische Verortung | 188 | ||
| 5.6 Zusammenfassung | 189 | ||
| 6. Textmustereigenschaften des spätmittelalterlichenKanzleibriefs | 191 | ||
| 6.1 Struktur und Themenentfaltung | 191 | ||
| 6.2 Funktion | 196 | ||
| 6.3 Situation | 200 | ||
| 6.3.1 Kommunikationsbereich | 200 | ||
| 6.3.2 Kommunikationspartner | 202 | ||
| 6.3.3 Kommunikationsform | 206 | ||
| 6.4 RhetorischstilistischePrinzipien | 208 | ||
| 6.5 Zusammenfassung | 211 | ||
| 7. Variation im spätmittelalterlichen Kanzleibrief | 215 | ||
| 7.1 Diachroner Wandel | 215 | ||
| 7.1.1 Die Entwicklung der Anreden | 216 | ||
| 7.1.2 Die Entwicklung der Gegenseitigkeitsformel | 220 | ||
| 7.2 Diatopische Unterschiede | 225 | ||
| 7.2.1 Textmuster zwischen idiolektalem und kanzleispezifischem Gebrauch | 226 | ||
| 7.2.2 Textmuster im überregionalen Vergleich | 228 | ||
| 7.3 Zusammenfassung | 240 | ||
| 8. Zusammenfassung und Schlussbetrachtung | 243 | ||
| 8.1 Das Textmuster des spätmittelalterlichen Kanzleibriefs | 243 | ||
| 8.2 Zur integrativen Beschreibung von (historischem) Textmusterwissen | 246 | ||
| Literaturverzeichnis | 249 | ||
| Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen | 271 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 275 | ||
| Anhang | 277 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish