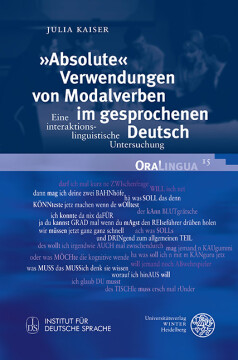
BUCH
»Absolute« Verwendungen von Modalverben im gesprochenen Deutsch
Eine interaktionslinguistische Untersuchung
OraLingua, Bd. 15
2017
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Modalverben gehören zu den hochfrequenten Verben des Deutschen und weisen in der gesprochenen Sprache eine hohe grammatische, semantische und funktionale Flexibilität auf. Die Studie befasst sich aus interaktionslinguistischer Sicht mit dem Verwendungsspektrum von Konstruktionen, in denen Modalverben »absolut«, das heißt hier: ohne infinites Vollverb, gebraucht werden. Es wird untersucht, welche Bedeutungen die Modalverben in Interaktionen haben bzw. welche Faktoren ihre Interpretation beeinflussen und inwiefern die jeweiligen Konstruktionen für spezifische sprachliche Handlungen und in speziellen interaktiven Kontexten verwendet werden. Als entscheidend für die Analyse zeigen sich neben der signifikanten Medialitätsdifferenz auch Interaktivität, ‚online‘-Produktion und Gattungs- bzw. Registermerkmale wie Informalität. Die Studie demonstriert außerdem, dass die Modalverbkonstruktionen sehr unterschiedliche Grade von Schematizität, Spezifizität und (Nicht-) Kompositionalität aufweisen.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | Cover | ||
| Titel | III | ||
| Impressum | IV | ||
| Inhalt | V | ||
| Danksagung | IX | ||
| 1 Einleitung | 1 | ||
| 1.1 Gegenstand der Arbeit | 1 | ||
| 1.2 Die Klasse der Modalverben in der Forschung | 2 | ||
| 1.3 Aufbau der Arbeit | 4 | ||
| 1.4 Methoden und Ziele | 5 | ||
| 2 Modalverben in der Forschung – Problemorientierter Literaturüberblick | 7 | ||
| 2.1 Syntax und Semantik, Diachronie und synchrone Systematiken | 7 | ||
| 2.2 Modalverben und Modalität | 15 | ||
| 2.3 Modalverben und Pragmatik | 20 | ||
| 2.4 Verbstatus der absoluten Verwendungen: Elliptizität und Anaphorik, Ergänzbarkeit und Konventionalität | 27 | ||
| 2.5 Zwischenfazit | 35 | ||
| 3 Theorie und Methodik | 39 | ||
| 3.1 Theoretischer und methodischer Rahmen: Konversationsanalyse und Interaktionale Linguistik | 39 | ||
| 3.2 Weitere Ansätze I – Verb und Bedeutung | 45 | ||
| 3.3 Weitere Ansätze II – Verb und Konstruktion | 52 | ||
| 3.4 Weitere Ansätze III – Verb und Handlung | 65 | ||
| 3.5 Zusammenfassung, Analyseschema und Vorgehen | 77 | ||
| 4 Datengrundlage | 83 | ||
| 4.1 Korpusauswahl und -deskription, Datentranskription und Kollektionsbildung | 83 | ||
| 4.2 Datenkodierung | 92 | ||
| 4.3 Quantitativer Überblick | 96 | ||
| 5 Empirische Analyse: "mögen/möchte(n)" und "wollen" | 101 | ||
| 5.1 Quantitativer Überblick und Lexembedeutung(en | 101 | ||
| 5.1.1 Überblick Lexemspezifik | 105 | ||
| 5.2 "mögen/möchte(n)" und "wollen" mit (lexikalischem/indefinitem) Akkusativobjekt | 107 | ||
| 5.3 Verweisstrukturen | 131 | ||
| 5.3.1 Anaphorische/analeptische Verweisstrukturen im Hauptsatz – turnintern oder interaktiv (adjazent) | 132 | ||
| 5.3.2 Verwendungen mit Komplementsatz | 143 | ||
| 5.3.3 Verweisstrukturen im Nebensatz – turnintern | 147 | ||
| 5.4 Konstruktionale Muster | 162 | ||
| 5.4.1 Verwendungen mit Direktivbestimmung | 162 | ||
| 5.4.2 wollen in idiomatischen Konstruktionen | 167 | ||
| 5.5 Zusammenfassung: Faktoren der Lesartenkonstitution und beobachtete Handlungen | 173 | ||
| 6 Empirische Analyse: "können" | 177 | ||
| 6.1 Quantitativer Überblick und Lexembedeutung(en | 177 | ||
| 6.1.1 Überblick Lexemspezifik | 178 | ||
| 6.2 "können" mit (lexikalischem/indefinitem) Akkusativobjekt | 180 | ||
| 6.3 Anaphorische und analeptische Verweisstrukturen im Hauptsatz und Nebensatz (turnintern und interaktiv) | 191 | ||
| 6.3.1 Verweisstrukturen im Hauptsatzformat | 191 | ||
| 6.3.2 Verweisstrukturen im Nebensatzformat | 202 | ||
| 6.4 Konstruktionale Muster | 206 | ||
| 6.4.1 Verwendungen mit Direktivbestimmung | 206 | ||
| 6.4.2 "können" in idiomatischen Konstruktionen | 208 | ||
| 6.5 Zusammenfassung: Faktoren der Lesartenkonstitution und beobachtete Handlungen | 214 | ||
| 7 Empirische Analyse: "dürfen" und "sollen" | 217 | ||
| 7.1 Quantitativer Überblick und Lexembedeutung(en) | 217 | ||
| 7.1.1 Überblick Lexemspezifik | 219 | ||
| 7.2 "dürfen" mit akkusativischem Indefinitpronomen und in (objektlosen) Situationsellipsen, "sollen" mit Objekt in Situationsellipsen | 221 | ||
| 7.3 Anaphorische/analeptische Verwendungen in koordinierten und subordinierten Strukturen (turnintern und interaktiv) | 229 | ||
| 7.4 Konstruktionale Muster | 234 | ||
| 7.4.1 Verwendungen mit Direktivbestimmung | 234 | ||
| 7.4.2 "sollen" in idiomatischen Konstruktionen | 237 | ||
| 7.5 Zusammenfassung: Faktoren der Lesartenkonstitution und beobachtete Handlungen | 249 | ||
| 8 Empirische Analyse: "müssen" | 253 | ||
| 8.1 Quantitativer Überblick und Lexembedeutung(en) | 253 | ||
| 8.1.1 Überblick Lexemspezifik – "müssen" und "nicht brauchen" | 254 | ||
| 8.2 "müssen" in Situationsellipsen mit (lexikalischem) Akkusativobjekt und objektlos | 257 | ||
| 8.3 Anaphorische/analeptische Verwendungen in koordinierten und subordinierten Verweisstrukturen (turnintern/interaktiv) | 261 | ||
| 8.4 Konstruktionale Muster | 266 | ||
| 8.4.1 Verwendungen mit Direktivbestimmung | 266 | ||
| 8.4.2 "müssen" in idiomatischen Konstruktionen | 280 | ||
| 8.5 Zusammenfassung: Faktoren der Lesartenkonstitution und beobachtete Handlungen | 283 | ||
| 9 Theoretische Schlussbetrachtung | 287 | ||
| 9.1 Semantik, Grammatik und Handlung: Die komplexe Bedeutungs und Handlungskonstitution absoluter Modalverbverwendungen | 287 | ||
| 9.2 Fazit und Ausblick | 300 | ||
| 10 Literatur | 303 | ||
| Anhang | 327 | ||
| I Transkriptionskonventionen | 327 | ||
| II Übersicht über die untersuchten Gespräche: FOLK A, B, C | 329 | ||
| Backcover | 333 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish