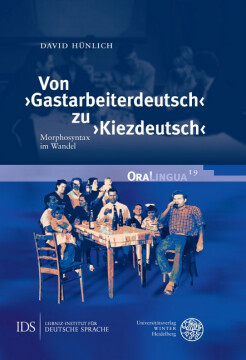
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Unter dem Schlagwort ›Kiezdeutsch‹ wurde in den letzten zehn Jahren intensiv über die Herkunft des deutschen Multiethnolekts diskutiert, der von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund genutzt wird. Handelt es sich bei den typischen Merkmalen um altersgebundene Stilisierungen? Oder avanciert die Jugendsprache zu einem neuen Dialekt des Deutschen? Einig war man sich bisher nur darin, dass der Multiethnolekt keine Fortsetzung der Lernermerkmale der Gastarbeitergeneration darstellt. Ein Vergleich von sieben Merkmalen in über 50 Studien der letzten 50 Jahre lässt diese Prämisse fraglich erscheinen. Der vorliegende Band liefert eine Erklärung der Variation in der Morphosyntax, die mit den Schritten der Koinéisierung im Einklang steht und den kollektiven Sprachwechsel ins Deutsche berücksichtigt: Über mehrere Generationen und Lebensabschnitte erfolgt eine Weitergabe, Abnahme und Funktionalisierung der Merkmale, wobei ethnische Grenzen zunehmend verschwimmen.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | III | ||
| Impressum | IV | ||
| Inhalt | VII | ||
| Präliminarien | 1 | ||
| 1 Einleitung | 3 | ||
| 1.1 Eine Lücke in der Migrationsforschung | 5 | ||
| 1.2 Definition der Multiethnolekte | 9 | ||
| 1.3 Alternative Ursprünge multiethnolektalen Sprechens | 13 | ||
| 1.4 Struktur der Monografie | 20 | ||
| 2 Sieben Morphosyntaktische Merkmale des Deutschen | 23 | ||
| 2.1 Deklination: Uneindeutige Zuordnung von Form und Funktion | 24 | ||
| 2.2 Artikel | 30 | ||
| 2.3 Pronomen | 31 | ||
| 2.4 Präpositionen | 33 | ||
| 2.5 Verbkonjugation | 33 | ||
| 2.6 Wortstellung und Satzklammer | 36 | ||
| 2.7 Der Existenzausdruck ‚es gibt‘ | 39 | ||
| 2.8 Interferenz aus den Einwanderersprachen? | 42 | ||
| 3 Der Spracherwerb der Einwanderergeneration (Generation 1) | 47 | ||
| 3.1 Soziolinguistische Merkmale (Generation 1) | 50 | ||
| 3.1.1 ‚Pidgin-Deutsch‘: eine interethnische Verkehrssprache in der BRD? | 50 | ||
| 3.1.2 ‚Gruppen-Interlingua‘: Lernerstrategien auf dem Weg zum Standard | 54 | ||
| 3.1.3 ‚Gastarbeiterdeutsch‘ in der jugoslawischen Community | 59 | ||
| 3.1.4 ‚Gastarbeiterdeutsch‘ in der türkischen Community | 60 | ||
| 3.1.5 ‚Sprecherkontakt‘: Deutsch im Ausländerwohnheim | 63 | ||
| 3.1.6 Foreigner Talk: Imitation oder Wechselbeziehung? | 65 | ||
| 3.1.7 Die Wende: Politische und Sprachliche Umbrüche | 67 | ||
| 3.2 Morphosyntaktische Merkmale (Generation 1) | 69 | ||
| 3.2.1 Variation in der Deklination | 70 | ||
| 3.2.2 Nicht-Verwendung von Artikeln | 73 | ||
| 3.2.3 Nicht-Verwendung von Pronomen | 77 | ||
| 3.2.4 Nicht-Verwendung von Präpositionen | 80 | ||
| 3.2.5 Abweichungen in der Verbkonjugation | 85 | ||
| 3.2.6 Mehrfache und fehlende Vorfeldbesetzung | 90 | ||
| 3.2.7 Der monomorphemische Existenzmarker ‚gibs‘ | 94 | ||
| 3.3 Zusammenfassung und Interpretation | 96 | ||
| 4 Der Spracherwerb der migrierten Kinder (Generation 1.5) | 105 | ||
| 4.1 Soziolinguistische Merkmale (Generation 1.5) | 106 | ||
| 4.1.1 ‚Interferenzen‘ im Deutsch türkischer Kinder? | 106 | ||
| 4.1.2 Zweitspracherwerb italienischer Arbeiterkinder | 107 | ||
| 4.1.3 ‚Intra-Gruppenbilingualismus‘: Frühe Zweisprachigkeit in jugoslawischen Familien | 110 | ||
| 4.1.4 ‚Kreolisierung‘ oder Entstehung von ethnischen Dialekten? | 112 | ||
| 4.1.5 Zweitspracherwerb und Sprachlernbedingungen türkischer Jugendlicher | 113 | ||
| 4.1.6 Stadt vs. Land: Selbstangaben zum Deutsch türkischer Jugendlicher | 116 | ||
| 4.1.7 Aussiedlerkinder und türkische Kinder im Vergleich | 117 | ||
| 4.2 Morphosyntaktische Merkmale (Generation 1.5) | 119 | ||
| 4.2.1 Variation in der Deklination | 119 | ||
| 4.2.2 Nicht-Verwendung von Artikeln | 125 | ||
| 4.2.3 Nicht-Verwendung von Pronomen | 131 | ||
| 4.2.4 Nicht-Verwendung von Präpositionen | 136 | ||
| 4.2.5 Abweichungen in der Verbkonjugation | 139 | ||
| 4.2.6 Mehrfache oder Fehlende Vorfeldbesetzung | 144 | ||
| 4.2.7 Der monomorphemische Existenzmarker ‚gibs‘ | 148 | ||
| 4.3 Zusammenfassung und Interpretation | 150 | ||
| 5 Der Spracherwerb von Kindern mit Migrationshintergrund (Generation 2/2.5/3) | 163 | ||
| 5.1 Soziolinguistische Merkmale (Generation 2/2.5/3) | 165 | ||
| 5.1.1 Früher Zweitspracherwerb bei Eintritt in den Kindergarten | 165 | ||
| 5.1.2 Deutsch als Frühe Zweitsprache: Zweite Erstsprache? | 170 | ||
| 5.1.3 Sprachförderung im letzten Kindergartenjahr | 175 | ||
| 5.1.4 Sprachstand im ersten Schuljahr | 179 | ||
| 5.1.5 Profilanalyse und Schriftsprache im Verlauf der Grundschule | 181 | ||
| 5.1.6 Mündliche Sprache in der 3. und 4. Klasse | 185 | ||
| 5.1.7 Deutsch in der Grundschule: Zweitsprache oder Erstsprache? | 187 | ||
| 5.2 Morphosyntaktische Merkmale (Generation 2/2.5/3) | 194 | ||
| 5.2.1 Variation in der Deklination | 194 | ||
| 5.2.2 Nicht-Verwendung von Artikeln | 201 | ||
| 5.2.3 Nicht-Verwendung von Pronomen | 204 | ||
| 5.2.4 Nicht-Verwendung von Präpositionen | 206 | ||
| 5.2.5 Abweichungen in der Verbkonjugation | 209 | ||
| 5.2.6 Mehrfache und fehlende Vorfeldbesetzung | 211 | ||
| 5.2.7 Der monomorphemische Existenzmarker ‚gibs‘ | 214 | ||
| 5.3 Zusammenfassung und Interpretation | 215 | ||
| 6 Ethnolekte und Multiethnolekte (Generation 1.5/2/2.5/3) | 225 | ||
| 6.1 Multiethnolekte in Europa | 228 | ||
| 6.2 Multiethnolekte in Deutschland: Soziolinguistische Merkmale (Generation 1.5/2/2.5/3) | 234 | ||
| 6.2.1 ‚Kanak Sprak‘: eine ethno-soziolektale Varietät | 235 | ||
| 6.2.2 ‚Türkenslang‘: Der Frühe Ethnolekt | 237 | ||
| 6.2.3 ‚Türkendeutsch‘: ein Stil der Türkischstämmigen | 245 | ||
| 6.2.4 ‚Ghettodeutsch‘ im gemischten Repertoire | 249 | ||
| 6.2.5 ‚Kiezdeutsch‘: ein Multiethnolekt im ‚System des Deutschen‘ | 253 | ||
| 6.2.6 ‚Multi-Kulti-Deutsch‘ bis ‚Kontaktdeutsch‘: Reaktionen auf Kiezdeutsch | 258 | ||
| 6.2.7 Die multiethnolektale Jugendsprache | 266 | ||
| 6.3 Morphosyntaktische Merkmale (Generation 1.5/2/2.5/3) | 268 | ||
| 6.3.1 Variation in der Deklination | 268 | ||
| 6.3.2 Nicht-Verwendung von Artikeln | 272 | ||
| 6.3.3 Nicht-Verwendung von Pronomen | 278 | ||
| 6.3.4 Nicht-Verwendung von Präpositionen | 282 | ||
| 6.3.5 Abweichungen in der Verbkonjugation | 286 | ||
| 6.3.6 Mehrfache und Fehlende Vorfeldbesetzung | 288 | ||
| 6.3.7 Der monomorphemische Existenzmarker ‚es gibs‘ | 292 | ||
| 6.4 Zusammenfassung und Interpretation | 293 | ||
| 7 Synthese | 301 | ||
| 7.1 Wellen der Nivellierung | 302 | ||
| 7.2 Einschränkungen | 307 | ||
| 7.3 Interpretation | 308 | ||
| Literatur und Quellen | 315 | ||
| Appendix | 333 | ||
| Grundlage der Synthese in Kapitel 7 | 333 | ||
| Konventionen für Glossierungen und Transkriptionen | 338 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish