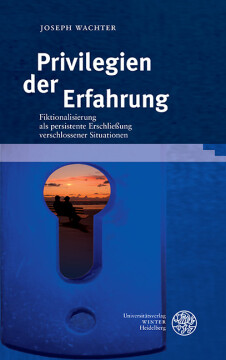
BUCH
Privilegien der Erfahrung
Fiktionalisierung als persistente Erschließung verschlossener Situationen
Probleme der Dichtung, Bd. 50
2014
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Die bisherige Diffusion beim Umgang mit dem Begriff ,Fiktion‘ resultiert aus der Verkennung des Phänomens ,fiktional‘. Es wurde übersehen, dass fiktionale Gebilde ,Persistenz‘ voraussetzen, das Privileg des szenischen Dabeiseins und -bleibens in verschlossenen Situationen, deren Verkettung als Handlungsnexus erfahrbar wird. Das Fiktionsfeld fingiert, fiktiv und fiktional kann nun intern differenziert und extern vom Feld der Ästhetisierungen abgegrenzt werden. Die Frage nach Symptomen findet so ihre Beobachtungssonde für filmische, narrative, dramatische und lyrische Gebilde. Diese geschärfte Konzeption ermöglicht die Verzahnung von Erzähl- und Fiktionstheorie mit dem Ergebnis einer phänomenanalytisch gewonnenen Terminologie (z.B. navigierende/begleitende Persistenz). Sie wird erprobt in Auseinandersetzungen mit bisherigen Erzähltheorien, mit Whites ‚Metahistory‘, Luhmanns systemtheoretischen Literatur-Beobachtungen und Habermas‘ diskurstypologischen Abgrenzungsversuchen.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Vorbemerkung | V | ||
| Inhalt | 1 | ||
| Einleitung | 7 | ||
| 1. Kapitel: Ontologisch-terminologische Absicherungen | 17 | ||
| 1. Die medial vermittelte Wirklichkeit | 17 | ||
| 1.1. Erscheinende und scheinhafte Wirklichkeit | 18 | ||
| 1.2 Schein als verrücktes Erscheinen | 20 | ||
| 1.3 Metaphorischer Schein | 20 | ||
| 1.4 Metonymisch täuschender Schein | 24 | ||
| 1.5 Der Anschein der Wahrheit: Wahrscheinlichkeit | 25 | ||
| 1.6 Der ästhetische und der fiktionale Schein | 26 | ||
| 1.7 Schein und Illusionsbildung: ein Beispiel | 28 | ||
| 2. Welten und Einstellungen | 30 | ||
| 2.1 Differenzierung der Welten | 30 | ||
| 2.2 Einstellungen zur Wirklichkeit | 33 | ||
| 3. Möglichkeiten der Fiktionsbildung | 36 | ||
| 3.1 Fingieren, fiktivieren, fiktionalisieren | 36 | ||
| 3.2 Der terminologische Rest: ‚Fiktion’ | 42 | ||
| 2. Kapitel: Sondierung der ‚Persistenz‘. Leistungen und Funktionen | 44 | ||
| 1. Filmische Fiktion: Dabeisein und Dabeibleiben | 44 | ||
| 1.1 Parkbank | 44 | ||
| 1.2 Persistenz | 46 | ||
| 1.3 Omaha Beach: die Gefahren des bloßen Dabeiseins | 47 | ||
| 1.4 “Phoenix, Arizona, 2.43. p.m.” | 48 | ||
| 1.5 Der Mord unter der Dusche | 51 | ||
| 1.6 Das Fenster zum Hof | 56 | ||
| 2. Zwischenreflexion: Handlung und Mimesis | 58 | ||
| 2.1 Aspekte des allgemeinen Handlungsbegriffs | 58 | ||
| 2.2 Mimetische Handlung | 59 | ||
| 2.3 Mimesis als „Nachahmung“ einer Handlung? | 60 | ||
| 3. Differenzierungen und Abgrenzungen | 64 | ||
| 3.1 Persistenz durch Sprache | 64 | ||
| 3.2 Erfinden und Beschreiben | 66 | ||
| 3.3 Historisches und persistentes Erzählen | 68 | ||
| 3.4 Fiktionssymptome und Persistenz | 84 | ||
| 3.5 Die Erlebnisqualität des epischen Präteritums | 86 | ||
| 3.6 „Ich-Origo“ und Persisten | 91 | ||
| 3.7 „Erzählsituationen“ und Persistenz | 97 | ||
| 3. Kapitel: Spielarten der Persistenz in der narrativen Textur ‒ Erzähltheoretische Auswirkungen | 102 | ||
| 1. Navigierende Persistenz | 102 | ||
| 1.1 Flauberts gottgleiches Erzählen: Salammbô | 103 | ||
| 1.1.1 Der Spielraum der Persistenz: die Szene und ihre Tiefenstrukturen | 106 | ||
| 1.1.2 Weltorientierung durch Persistenz | 114 | ||
| 1.1.3 Kosmo-logische Funktionen der Persistenz | 118 | ||
| 1.2 Psycho-Logik | 123 | ||
| 1.3 Historizität und Handlungsintegration | 126 | ||
| 2. Begleitend-fokussierende Persistenz | 129 | ||
| 2.1 Personale Erzählsituation und persistente Perspektivik | 129 | ||
| 2.2 Ablösung vom Paradigma der Visualität | 133 | ||
| 2.3 Vorstellung und Vorstellbarkeit der Figuren | 135 | ||
| 2.4 Zwischenreflexion: Diskurs als generative Persistenz | 141 | ||
| 2.4.1 Abgrenzung 1: Diskurs und Megadiskurs | 142 | ||
| 2.4.2 Abgrenzung 2: Diskurs und Proposition | 145 | ||
| 2.4.3 Abgrenzung 3: Diskurs und Interaktion | 147 | ||
| 2.5 Virtualisierung 1: Um sein Leben erzählen (1001 Nacht) | 150 | ||
| 2.6 Virtualisierung 2: Erzählen als Argumentieren (Nathan der Weise) | 153 | ||
| 2.7 Vor dem Diskurs: Äußerungen und Vorschriften | 155 | ||
| 2.8 Diskursiv verwandeltes Erleben (Ein fliehendes Pferd) | 157 | ||
| 3. Reflektierte Persistenz und Erzähler-Ich | 166 | ||
| 3.1 Humoristisches Erzählen und Persistenzbewusstsein | 167 | ||
| 3.2 ‚Allwissenheit‘ und ichzentrierter Diskurs | 175 | ||
| 3.3 Zu Robbe-Grillets erzähltechnischem Verwirrspiel | 178 | ||
| 4. Okkurrent-erinnerndes Erzählen und persistente Präsentation | 186 | ||
| 4.1 Fiktionalisierung der Ich-Erzählung | 190 | ||
| 4.2 Transpragmatische Exkursionen und diskursive Verwerfungen | 192 | ||
| 4.3 Schriftliche Artikulation: Fingiert oder persistent präsentiert? | 199 | ||
| 4.4 Mimetische Okkurrenz, gesprochener Diskurs | 211 | ||
| 4.5 Kategoriale Engführung | 222 | ||
| 5. Literarische Kommunikation und Fiktionalität (Anderegg) | 225 | ||
| 5.1 Fiktionssignale vs. Fiktionssymptome | 225 | ||
| 5.2 Kommunikation und Präsuppositionen | 229 | ||
| 5.3 Die theoretische Bevorzugung des vortheoretischen Lesers | 232 | ||
| 5.4 Kritik an den Fiktionssymptomen | 234 | ||
| 5.5 Kontextabhängigkeit von Symptomen? | 237 | ||
| 5.6 „Geschlossenheit“ fiktionaler Texte? | 241 | ||
| 6. Narratologie und Fiktionstheorie (Genette, Schmid) | 244 | ||
| 6.1 Fiktionssymptome und Privilegien | 245 | ||
| 6.2 Konditionalistische Argumente | 248 | ||
| 6.3 Perspektivische Nachlässigkeiten | 251 | ||
| 6.4 Diegesis und Mimesis: Platons Unterscheidung | 252 | ||
| 6.5 Fokalisierungen im diegetisch-mimetischen Feld | 256 | ||
| 6.6 Zum Status der erlebten Rede | 263 | ||
| 6.7 Diegetisch-mimetische Kombinatorik und Rahmenerzählung | 265 | ||
| 4. Kapitel: Persistenz im Drama und im Gedicht ‒ Situationstheoretischer Systematisierungsversuch | 271 | ||
| 1. Fiktionalisierungen im Drama | 271 | ||
| 1.1 Die vergessene Mimesis: Käte Hamburgers Überlegungen zum „Verhältnis der dramatischen zur epischen Fiktion“ | 272 | ||
| 1.2 Gottscheds Schlossvorhof | 278 | ||
| 1.3 Öffentliche Präsentationsformen | 294 | ||
| 1.3.1 Spiel- und Handlungsfelder als Bühnen: vormimetische Präsentationen | 296 | ||
| 1.3.2 Hinter der Schwelle: die beschränkten Möglichkeiten rezeptionspragmatischen Illusionismus | 308 | ||
| 1.4 Fixiert-fixierende Persistenz | 316 | ||
| 1.4.1 Das Theater, nichts anderes als es selbst | 317 | ||
| 1.4.2 Schwellen der örtlichen und situativen Privilegierung | 320 | ||
| 1.4.3 Irritabilität: Versuch einer systemtheoretischen Deutung | 331 | ||
| 1.5 Navigierend-springende und reflektierte Persistenz | 340 | ||
| 1.5.1 Phantastische Orte | 340 | ||
| 1.5.2 Lokal und temporal navigierende Persistenz | 341 | ||
| 1.5.3 Raum | 342 | ||
| 1.5.4 Zeit | 343 | ||
| 1.5.5 Ich-zentrierte dramatische Persistenz: Rollendiskrepanz | 344 | ||
| 2. Lyrik: Zugänge zu Mitteilungen aller Art | 347 | ||
| 2.1 Die Mitteilung als lyrische Grundhandlung | 348 | ||
| 2.2 Lyrisches Sprechen als mitteilungslose Wirklichkeitssaussage? - Zu Käte Hamburgers Deutung der Lyrik | 355 | ||
| 2.3 Situativ-temporale Topik lyrischer Fiktionalisierungen | 365 | ||
| 2.3.1 Nicht-Fiktionalität: das Präsens als Tempus theoretischer Gegenwärtigkeit | 366 | ||
| 2.3.2 Theoretische Vergegenwärtigung | 371 | ||
| 2.3.3 Pertinentes Präsens und Präsentationsstruktur | 374 | ||
| 2.3.4 Wahrnehmungsdiskurse | 379 | ||
| 2.3.5 Erleben und lyrischer Diskurs | 388 | ||
| 2.4 Adressierte Diskurse, Apostrophen | 392 | ||
| 2.5 Das diskursive Subjekt als Chor, chorisches Sprechen | 396 | ||
| 2.6 Lyrisches Erzählen: Präteritum (Bezug auf ein ‘Erlebnis’) | 400 | ||
| 2.7 Zusammenfassung: Lyrik und Fiktionalität | 407 | ||
| 3. Transpragmatik, Situationen als Weltzellen | 413 | ||
| 3.1 Situationen überhaupt | 416 | ||
| 3.2 Situationen: ein Typologisierungsversuch | 418 | ||
| 3.3 Ästhetische Einstellung und Situationskomplexion | 421 | ||
| 3.4 Möglichkeiten dokumentarischer Zugänge | 422 | ||
| 3.5 Ein Gedankenexperiment: die negative Utopie der absoluten filmischen Zugänglichkeit. | 426 | ||
| 3.6 Prägnanzkompetenz | 427 | ||
| 3.7 Privilegierte Zugänge, Exklusivität und Irritabilität | 428 | ||
| 3.8 Schematisierungsversuche: topische und situative Hermetik | 430 | ||
| 5. Kapitel: Soziologisch-philosophische Hinsichten auf Fiktionen und Fiktionalisierungen. Luhmann und Habermas | 437 | ||
| 1. Systeme und Beobachtbarkeiten (Luhmann) | 437 | ||
| 1.1 Luhmanns Fiktionsbegriff: „reale und fiktionale Realität“ | 438 | ||
| 1.2 Religion und Kunst: Wiedereintritt von Unterscheidungen | 442 | ||
| 1.3 Persistenz und die „Linie des Teufels“ | 445 | ||
| 1.4 Persistenz und systemtheoretische Beobachtbarkeit | 449 | ||
| 1.5 Luhmanns Kommunikationsbegriff: Probleme a limine | 451 | ||
| 1.6 Situationen und Interaktionen / Kommunikationen | 453 | ||
| 1.7 Bewusstsein vor und während der Kommunikation | 457 | ||
| 1.8 Kunst als „Kompaktkommunikation“ | 460 | ||
| 1.9 Kommunikation, Formwahrnehmung und Fiktionalität | 466 | ||
| 1.10 Ontische Indikatoren und Konstruktivismus | 472 | ||
| 1.10.1 Radikaler Konstruktivismus: Unterscheidungen und Unterschiede | 476 | ||
| 1.10.2 Luhmanns operationaler Konstruktivismus, ontologisch beobachtet | 480 | ||
| 1.10.3 Die literaturwissenschaftliche Sonderstellung der Fiktionstheorie | 498 | ||
| 2. Wahrheitsansprüche und Diskurstypen (Habermas) | 501 | ||
| 2.1 Philosophie und Literatur: Differenzierungsbemühungen | 502 | ||
| 2.2 Illokution, Poetizät und Fiktionalisierung | 510 | ||
| 2.3 Poetische und fiktionale Welterschließung (mit Franks Einwänden) | 518 | ||
| Literaturverzeichnis | 529 | ||
| Personenregister | 539 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish