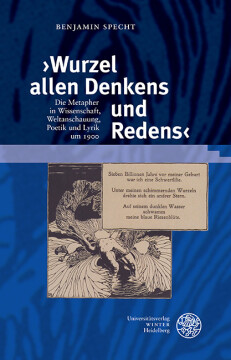
BUCH
›Wurzel allen Denkens und Redens‹
Die Metapher in Wissenschaft, Weltanschauung, Poetik und Lyrik um 1900
Probleme der Dichtung, Bd. 52
2017
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Die Metapher steht um 1900 am Schnittpunkt vieler wissenschaftlicher und weltanschaulicher Debatten: in Ästhetik und Linguistik ebenso wie in Psychologie, Anthropologie und Erkenntnistheorie. Stets wird mit ihr das fundamentale Verhältnis von Sache, Vorstellung und Sprache erörtert. Auch wenn die Konzepte sich stark unterscheiden, verbindet dieses gemeinsame Problem die beteiligten Diskurse und verknüpft es überdies mit der zeitgeschichtlichen Frage nach der ‚Moderne‘. Vor allem die Lyriker der Zeit sehen sich vor der riskanten Aufgabe, für ihre Epoche eine ‚metaphorische‘ Anbindung von Bewusstseinsstand und Lebenswelt zu leisten wie schon in vergangenen Perioden. Darin treffen sich Berliner und Wiener Moderne. Dies lässt sich exemplarisch an Poetik und Dichtung von Hugo von Hofmannsthal und Arno Holz verdeutlichen. Beide Autoren nehmen die disziplinären und kulturdiagnostischen Wissensbestände detailliert zur Kenntnis und entwickeln sie literarisch weiter. An ihrem Werk lässt sich so erkennen, wie Literatur und Wissenschaft einander im Zeichen der Metapher genau und kritisch beobachten.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | Cover | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhalt | 5 | ||
| 1 ‚Wurzel allen Denkens und Redens‘. Die Frühe Moderne, das ‚Metaphorische‘ und die Metapher | 11 | ||
| 2 Metapher, Wissen, Lyrik. Zur Struktur und den literarischen Funktionen metaphorischer Rede | 41 | ||
| 2.1 Systematik der Metapher. Debattenfelder der Metaphernforschung | 47 | ||
| 2.1.1 Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit | 48 | ||
| 2.1.2 Semiotische Ebenen des metaphorischen Prozesses | 53 | ||
| 2.1.3 Zusammenspiel der Sinnbezirke | 59 | ||
| 2.1.4 Transferformen zwischen den Sinnbezirken | 63 | ||
| 2.1.5 Ähnlichkeit | 73 | ||
| 2.2 Metaphern in Literatur und Lyrik. Funktionen, Strukturen und historische Abgrenzungen | 79 | ||
| 2.2.1 Potenzen metaphorischer Rede in literarischen Texten | 82 | ||
| 2.2.2 Tendenzen metaphorischer Rede in lyrischen Texten | 90 | ||
| 2.2.3 Metapher und Symbol um 1900 | 104 | ||
| 3 „Verbindung finden wir im Bilde“. Die Metapherndiskussion im späten 19. Jahrhundert | 111 | ||
| 3.1 Arbitrarität der Sprache und Relativität der Erkenntnis: die Metaphernreflexion beim frühen Friedrich Nietzsche | 117 | ||
| 3.1.1 ‚Sprachinstinkt‘ in "Vom Ursprung der Sprache" (1869) | 120 | ||
| 3.1.2 Metapher und Metaphysik in der "Geburt der Tragödie" (1872) und in den Nachlassnotizen | 123 | ||
| 3.1.3 Die erkenntnistheoretische Ausweitung des Metaphernbegriffs in Nietzsches "Darstellung der antiken Rhetorik" (1872/73) und Gustav Gerbers "Die Sprache als Kunst" (1871) | 131 | ||
| 3.1.4 Die Universalisierung des ‚Metaphorischen‘ in "Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne" (1873) | 139 | ||
| 3.2 Prinzip der Sprache: Metapher in der Sprachwissenschaft der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts | 146 | ||
| 3.2.1 Metapher bei der Entstehung der Sprache | 150 | ||
| 3.2.2 Metapher bei der Entwicklung der Sprache | 157 | ||
| 3.2.3 Metapher im Sprachsystem | 164 | ||
| 3.3 Figur der Assoziation: Metapher und (Physio-)Psychologie | 168 | ||
| 3.3.1 Psychophysik | 169 | ||
| 3.3.2 Elementenpsychologie | 177 | ||
| 3.3.3 Psychoanalyse | 181 | ||
| 3.4 Sinnbild der Partizipation: Metapher in Anthropologie, Völkerpsychologie und Mythenforschung | 190 | ||
| 3.4.1 Die Sprache in der Anthropologie des 19. Jahrhunderts | 191 | ||
| 3.4.2 Die Sprache in der Völkerpsychologie | 198 | ||
| 3.4.3 Metapher als Signum der frühesten Kulturstufen in Anthropologie und Völkerpsychologie | 206 | ||
| 3.4.4 Mythos und Metapher | 211 | ||
| 3.5 Medium der Erkenntnis: Metapher in Wahrnehmungsphysiologie, Erkenntnistheorie und Sprachkritik | 214 | ||
| 3.5.1 Metapher und Erkenntnistheorie I: Sinnesphysiologie und Wahrnehmungstheorie | 216 | ||
| 3.5.2 Metapher und Erkenntnistheorie II: Sprache und Denken | 219 | ||
| 3.5.3‚Prinzipielle Sprachkritik‘ und ihre Konsequenzen bei Mauthner und Landauer | 223 | ||
| 3.6 Spur von ‚Erlebnis‘ und ‚Einfühlung‘: Die Metapher und das ‚Metaphorische‘ in der akademischen Ästhetik und Poetik vor 1900 | 232 | ||
| 3.6.1 Produktionsästhetik: Erlebnis und ‚Bild‘ | 234 | ||
| 3.6.2 Rezeptionsästhetik: ‚Leihung‘ und ‚Einfühlung‘ | 244 | ||
| 4 Die „Bildhaftigkeit aller Dinge“. Reflexion und lyrische Praxis der Metapher bei Hugo von Hofmannsthal | 255 | ||
| 4.1 ‚Leben‘, Sprache und Poesie: Gegenwartsdiagnostik und Poetologie im essayistischen Werk | 264 | ||
| 4.1.1 Zeitdiagnostik: Moderne und ‚Leben‘ | 266 | ||
| 4.1.2 Sprachreflexion: Begriff und Metapher | 273 | ||
| 4.1.3 ‚Leben‘ und ‚Erlebnis‘ in Hofmannsthals Poetik | 279 | ||
| 4.2 Zwischen primärer Anschauung und unhintergehbarer Gleichnishaftigkeit. Hofmannsthals Metaphernreflexion im essayistischen Werk | 287 | ||
| 4.2.1 Metapher und Einheit: "Philosophie des Metaphorischen" (1894) | 289 | ||
| 4.2.2 Metapher und Differenz: "Bildlicher ausdruck" (1897) | 295 | ||
| 4.2.3 Metapher zwischen Einheit und Differenz: "Einleitung zu dem Buche genannt Erzählungen der Tausendundein Nächte" (1906) | 298 | ||
| 4.3 Durchbrüche des Eigentlichen: Hofmannsthals Tropologie in "Ein Brief" (1902) | 302 | ||
| 4.3.1 Chandos' Wirklichkeit: Raumzeitliche Koordinaten von "Ein Brief" | 306 | ||
| 4.3.2 Chandos' Krise: Die Metaphorizität der Sprache als Signum moderner Differenzerfahrung | 309 | ||
| 4.3.3 Chandos' ‚Augenblicke‘: Das ‚Metaphorische‘ als Identitätserlebnis | 315 | ||
| 4.3.4 Chandos' Brief: Sprechen im Wissen um die Defizite der Sprache | 323 | ||
| 4.4 Das Symbol und die ‚metaphorische‘ Partizipation in "Das Gespräch über Gedichte" (1903) | 325 | ||
| 4.4.1 Poesie zwischen Selbstreferenz und Lebensbezug | 327 | ||
| 4.4.2 Die Referenz des Symbols zwischen Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit | 332 | ||
| 4.4.3 Das Symbol und das Opfer | 335 | ||
| 4.4.4 Poesie als gebundener ‚Augenblick‘ | 343 | ||
| 4.5 „In unsern Worten liegt es drin“. Das ‚Metaphorische‘ und die Metaphorik in Hofmannsthals Lyrik | 346 | ||
| 4.5.1 Früheste Gedichte | 348 | ||
| 4.5.2 Gedichte der Einheit | 361 | ||
| 4.5.3 Gedichte der Differenz | 370 | ||
| 4.5.4 Gedichte von Einheit und Differenz | 381 | ||
| 5 Der „große Weg zur Natur zurück“. Poetische Programmatik und lyrische Metaphernpraxis bei Arno Holz | 409 | ||
| 5.1 „Kunst = Natur – x“. Konzept und Begründung des ‚Kunstgesetzes‘ in "Die Kunst. Ihr Wesen und ihre Gesetze" (1891/92) | 422 | ||
| 5.1.1 Das Kunstgesetz, seine Bedingungen und sein Status | 424 | ||
| 5.1.2 Kunst, Natur und Subjektivität | 430 | ||
| 5.1.3 Das ‚x‘: ‚Handhabung‘ und ‚Reproduktionsbedingungen‘ | 436 | ||
| 5.1.4 Plausibilisierungsstrategie I: Narrative Stilisierung der Biographie | 439 | ||
| 5.1.5 Plausibilisierungsstrategie II: Prätention von Wissenschaftlichkeit | 447 | ||
| 5.2 „Schau her, auch dies ist Poesie!“ Sprache, Dichtung und Moderne im "Buch der Zeit" (1886) und im ersten "Phantasus"-Zyklus | 450 | ||
| 5.2.1 Sprache, Dichtung und das Thema der Moderne im "Buch der Zeit" | 452 | ||
| 5.2.2 Poetischer Nexus von Innen- und Außenwelt im ersten "Phantasus"-Zyklus | 464 | ||
| 5.3 ‚Notwendiger Rhythmus‘. Weiterentwicklungen von Holz' Poetik beim Erscheinen des "Phantasus" von 1898/99 | 473 | ||
| 5.3.1 Die ‚Revolution der Lyrik‘ in der "Selbstanzeige" (1898) | 476 | ||
| 5.3.2 Die Debatte um den ‚notwendigen Rhythmus‘ im Anschluss an die "Selbstanzeige" | 481 | ||
| 5.4 ‚Ich bin X‘. Konzept und Umsetzung der metaphorischen "Phantasus"-Identität(en) in der Version von 1898/99 | 487 | ||
| 5.4.1 Metaphern als Erweiterung der Ausdrucksoptionen | 490 | ||
| 5.4.2 Das ‚Phantasus-Prinzip‘ als Einheit und Differenz von Welt und Ich | 492 | ||
| 5.4.3 Metaphorische Projektionen zwischen Mensch und Natur | 502 | ||
| 5.4.4 Metaphorische Projektion in andere menschliche Seinsmöglichkeiten | 507 | ||
| 5.4.5 Kosmische Projektionen | 515 | ||
| 5.4.6 Projektionen ins Phantastische | 520 | ||
| 5.5 Der "Phantasus" von 1916. Radikalisierung des ‚Metaphorischen‘ und Fortentwicklungen der Bildverfahren | 523 | ||
| 5.5.1 Konstanz und Weiterentwicklung der Poetik | 525 | ||
| 5.5.2 Der neue Rahmen | 532 | ||
| 5.5.3 Verfahren der ‚Metaphern im engeren Sinne‘ | 544 | ||
| 5.6 Die ‚Poetik der Zahl‘ und der Bedeutungsverlust der Metapher in den letzten Fassungen des "Phantasus" (1925, 1961/1929) | 551 | ||
| 5.6.1 Die ‚Zahlenarchitektonik‘ | 554 | ||
| 5.6.2 Holz und Reß' "Die Zahl als formendes Weltprinzip" (1926) | 560 | ||
| 5.6.3 Die Metapher unter Bedingung der ‚Zahlenarchitektonik‘ | 564 | ||
| 6 Die Rückkehr des Symbols. Eine Hypothese zur Konsolidierung des Metaphernproblems um 1900 | 571 | ||
| Literatur | 585 | ||
| 1 Siglen | 585 | ||
| 2 Texte vor und um 1900 | 585 | ||
| 3 Forschungsliteratur | 589 | ||
| Danksagung | 605 | ||
| Backcover | 607 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish