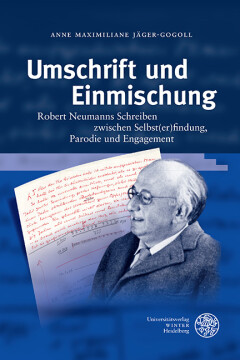
BUCH
Umschrift und Einmischung
Robert Neumanns Schreiben zwischen Selbst(er)findung, Parodie und Engagement
Jäger-Gogoll, Anne Maximiliane
Reihe Siegen. Beiträge zur Literatur-, Sprach- und Medienwissenschaft, Bd. 172
2015
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Zu Lebzeiten wurde er gern mit Superlativen bedacht, mit literarischen Fixsternen wie Lessing und Thomas Mann, Voltaire, Swift oder Balzac verglichen. Seit seinem Tod im Januar 1975 ist es still um Robert Neumann (1897–1975) und sein Werk geworden. Geblieben ist fast ausschließlich die Erinnerung an die brillanten Literaturparodien, mit denen Neumann 1927 schlagartig berühmt geworden war. Als eine der ersten umfangreicheren literaturwissenschaftlichen Untersuchungen widmet sich die vorliegende Studie zentralen Text- und Themenkomplexen von Neumanns Werk. Das Parodistische wird dabei nicht, wie bisweilen geschehen, als rezeptionsverfälschendes Moment, sondern als essentieller Bestandteil von Neumanns Schreiben verstanden, der für die autobiographischen Schriften und ihre literarische Inszenierung dynamischer Erinnerungsprozesse ebenso zentral ist wie für die politisch engagierten Bücher, bis hin zu dem 1965 im Kontext des Frankfurter Auschwitz-Prozesses erscheinenden Roman ‚Der Tatbestand oder Der gute Glaube der Deutschen‘.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | C | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhalt | 7 | ||
| UMSCHRIFT UND ENGAGEMENT. Zur Einleitung | 9 | ||
| I ZWISCHEN ZERSPLITTERUNG UND REKONSTRUKTION: ROBERT NEUMANNS AUTOBIOGRAPHIEN | 33 | ||
| I.1 Gegenstand und Kontext | 33 | ||
| I.1.1 Geschriebene Versionen des Ich: Autobiographie, Parodie, „Hochstapelei“ | 40 | ||
| I.1.2 Erinnerung, Wirklichkeit, „Wahrheit“ | 42 | ||
| I.1.3 Zeit | 43 | ||
| I.1.4 „Nachträglichkeit“ – Erinnerung(s)text und Variation | 47 | ||
| I.1.5 Untersuchungsschritte | 50 | ||
| I.2 „Ein Fetzenteppich des Lebens und Überlebens“: Ein leichtes Leben (1963) | 52 | ||
| I.2.1 Zeitstruktur und Themenfokus | 53 | ||
| I.2.2 Exil (und) Erzählen | 57 | ||
| I.3 Text, Subtext, Text(bless)ur – Prinzipien des Autobiographischen | 75 | ||
| I.3.1 Montage, Umschrift, Elision | 77 | ||
| I.4 Etappen literarischer Bewältigung: Vom Journal (1944/45) zu Absalom (1974) | 85 | ||
| I.4.1 Gegenstand und Kontext | 85 | ||
| I.4.2 Tod, Trauma, Trauerarbeit – das Tagebuch 1944 | 89 | ||
| I.4.3 Ambivalenz und Dekonstruktion – Die Ausgangskonstellation des Journal | 94 | ||
| I.4.4 Selbstreflexion durch die Augen des Anderen: Robert Neumann being the Journal and Memoirs of Henry Herbert Neumann edited by his father | 96 | ||
| I.4.5 „Verkapselung“. Zur literarischen Topik des biographischen Traumas in der autobiographischen Fiktion | 98 | ||
| I.4.6 „The wound which does not heal“: Trauma | 99 | ||
| I.4.7 Textueller Bruch und/versus narrative Sinngebung | 100 | ||
| I.4.8 Die Spur des Verstorbenen im Text – Henry Herbert Neumanns „Telephone Phantasy” | 104 | ||
| I.4.9 „Erinnerungsspur“ I | 108 | ||
| I.4.10 „Erinnerungsspur“ II | 111 | ||
| I.4.11 Die Wiedergewinnung des Erzählens – Zum literarischen Potential der Autobiographie | 115 | ||
| I.4.12 „It was a light life and gay…“ Absalom und „die Ermordung eines Sohnes“ | 122 | ||
| I.4.13 „…bezüglich des ganzen Buches recht ratlos…“ – Probleme der Fiktion | 125 | ||
| I.4.14 Symbolisierung des Misslingens: Titel und Motto | 131 | ||
| I.4.15 Das „leichte Leben“ – Roman und/versus Autobiographie | 136 | ||
| II ZWISCHEN EXIL UND REMIGRATION: DIE DUNKLE SEITE DES MONDES (1959) | 143 | ||
| II.1 Gegenstand und Kontext | 143 | ||
| II.2 Doppelte Böden | 152 | ||
| II.3 Symptomatologie der Remigration | 155 | ||
| II.4 Metaphern des Gedächtnisses / Arbeit der Erinnerung – Funktionen und Symptomatologie der Schrift | 161 | ||
| II.4.1 Zwischen Archiv und Tagebuch oder: Was ist Authentizität? | 163 | ||
| II.4.2 Archiv | 168 | ||
| II.4.3 Verborgen(es) und Enthüllt(es) | 171 | ||
| II.4.4 Tagebuch und „Testament“ | 173 | ||
| II.4.5 Schrift und Exil / Schrift im Exil | 177 | ||
| II.4.6 Tagebuch | 181 | ||
| II.4.7 Schrift als Symptom / Schrift als „Spur“ | 188 | ||
| II.4.8 Spuren und Spiegel | 195 | ||
| II.4.9 Beschwörung und Befreiung | 200 | ||
| II.5 Fazit | 202 | ||
| III ZWISCHEN WIRKLICHKEIT UND WAHRHEIT: DER TATBESTAND ODER DER GUTE GLAUBE DER DEUTSCHEN (1965) | 207 | ||
| III.1 Einleitendes | 207 | ||
| III.2 Kontexte | 209 | ||
| III.2.1 Werkkontext und Konzeption | 209 | ||
| III.2.2 Literarisch-politisches Diskursfeld | 217 | ||
| III.3 Gattungsfragen | 224 | ||
| III.3.1 Roman und Tagebuch | 227 | ||
| III.3.2 Untersuchung | 231 | ||
| III.4 Der Roman | 231 | ||
| III.4.1 Inhalt und Erzählstruktur | 231 | ||
| III.4.2 Figurenkonstruktion und Erzählprinzip I | 239 | ||
| III.5 Der Tatbestand – (k)ein Schlüsselroman? | 248 | ||
| III.5.1 Der Schlüsselroman als juristischer Fall: „Vogel“/Adler | 253 | ||
| III.5.2 Schlussfolgerungen | 262 | ||
| III.6 Figurenkonstruktion und Erzählprinzip II | 264 | ||
| III.6.1 „Cohn“ (Arendt) und Andere | 264 | ||
| III.6.2 Jenseits der Ironie: die „Verliebten“ | 277 | ||
| III.6.3 „Die beiden Kommunisten“: Pfeffer und Igel | 283 | ||
| III.6.4 „Sahl-Sobieski“/Reich-Ranicki und „Knecht“/Klett | 305 | ||
| III.7 Schlussfolgerung: „Tua res agitur“ – Schreiben nach Auschwitz | 327 | ||
| LITERATURVERZEICHNIS | 335 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish