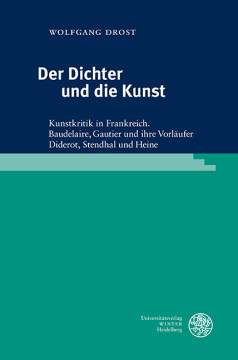
BUCH
Der Dichter und die Kunst
Kunstkritik in Frankreich. Baudelaire, Gautier und ihre Vorläufer Diderot, Stendhal und Heine
Herausgeber: Riechers, Ulrike
Reihe Siegen. Beiträge zur Literatur-, Sprach- und Medienwissenschaft, Bd. 180
2019
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Wie brachten die Dichter dem großen Publikum die Kunstwerke nahe, die in den öffentlichen ‚Salons‘ in Paris im Rhythmus von ein oder zwei Jahren ausgestellt wurden? Kunstkritik war oft nicht nur Kritik, sondern poetische Gestaltung des im Kunstwerk enthaltenen emotionellen Gehalts. Bildbetrachtung wurde als ein den ganzen Menschen erfüllendes Erleben angesehen. Persönliche von einem Kunstwerk ausgelöste Assoziationen und Glücksempfinden wurden kontrovers diskutiert; Stendhal beurteilte die Qualität eines Gemäldes nach seiner gleichsam erotischen Ausstrahlung; Diderot und Heine nutzten die Besprechung der Ausstellungen zu Plaudereien über Politik und Religion. Gautier wurde in seiner Leidenschaft für das tiefgründig Schöne zum Wegbereiter des ‚fin de siècle‘. Baudelaire formulierte Vorbehalte gegenüber dem sich bildenden Impressionismus sowie der Malerei seines Freundes Manet und skizzierte seine Vision der Moderne.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhalt | 5 | ||
| Vorwort | 11 | ||
| Vorbemerkung | 12 | ||
| I Was will Kunstkritik im 19. Jahrhundert? | 13 | ||
| Von der Macht der Dichter-Kritiker | 14 | ||
| Von der Rhetorik des Kunstwerks | 17 | ||
| Vom Recht auf ästhetischen Hedonismus – die Verlagerung des Kunstwerks in die Psyche des Betrachtenden | 18 | ||
| Von der absoluten Verfügungsgewalt über das Kunstwerk: Das Bildgedicht | 20 | ||
| Exkurs und Ausblick: Kunstkritik als eine Grundlage der Kunstgeschichte – Rezeption, Tourismus und historischer Ansatz | 23 | ||
| Bibliographische Notiz | 26 | ||
| II Von den Anfängen der französischen Kunstkritik | 27 | ||
| Mäzenatentum und Apotheose des Absolutismus | 27 | ||
| Vom Beginn der Kunstkritik: La Font de Saint-Yenne, Saint-Yves und Gougenot | 29 | ||
| Tragödiendichtung als Vorbild der Historienmalerei | 30 | ||
| Briefstil und Dialogstruktur | 32 | ||
| Interessevolles Wohlgefallen und Moralistik | 33 | ||
| Das Dilemma der Mimesis einer fehlerhaften Natur | 34 | ||
| Saint-Yves’ Offenheit für das Barock und seine Apologie der freien Faktur | 35 | ||
| Gegenwartsbezug: Mode – pro und contra | 36 | ||
| Bibliographische Notiz | 38 | ||
| III Denis Diderot (1713-1784) | 39 | ||
| Der Aufbruch: Das Ich gegen die Norm | 39 | ||
| Der Kunstkritiker als Aufklärer | 40 | ||
| Dialektische Strukturen von Diderots Kunstkritik | 42 | ||
| Moral und bürgerlicher Realismus | 45 | ||
| Kompositionsprinzipien und Öffnung zur Wirkästhetik: „Rapports und lignes de liaison“ | 45 | ||
| Bruch der Einheit von Gut und Böse | 49 | ||
| Vernet oder die Frage nach Gott | 50 | ||
| Gegen Mimesis von Natur und Antike | 52 | ||
| Natur als Regulativ und virtuelles Vorbild | 53 | ||
| Vom „modèle idéal“ zum „modèle intérieur“ | 54 | ||
| Bibliographische Notiz | 57 | ||
| IV Henri Beyle, genannt Stendhal (1783-1842) | 59 | ||
| Stendhals künstlerische Ausbildung | 59 | ||
| Unzulänglichkeiten des Dilettanten | 60 | ||
| Stendhal, ein radikalisierter Du Bos: Die Forderung nach Expressivität und Emotion | 62 | ||
| Die Absage an Kant: Erotik statt interesselosen Wohlgefallens | 65 | ||
| Schönheit, geschönte Hässlichkeit und utilitaristische Ästhetik | 70 | ||
| Soziologische und anthropologische Ansätze | 72 | ||
| Der Sturz des „beau idéal“ | 74 | ||
| Vom Künstlertum: Libido, Kreativität und Marketing | 76 | ||
| Zwischen Klassizismus und Romantik | 78 | ||
| Stendhal in den Augen der Großen: Goethe, Baudelaire, Delacroix und Nietzsche | 82 | ||
| Bibliographische Notiz | 84 | ||
| V Heinrich Heine (1797-1856) | 85 | ||
| Heine, ein willkommener Gast in Frankreich | 85 | ||
| Die Gemäldeausstellung in Paris 1831 | 86 | ||
| Heines Supranaturalismus | 87 | ||
| Heines hermeneutischer Ansatz: Die Berücksichtigung der Intention des Künstlers | 89 | ||
| Die „missverstandene Romantik“ | 91 | ||
| Dialektische Kritik: Delacroix’ „Die Freiheit führt das Volk“ | 92 | ||
| Verkehrung von Bild-Fakten: Delaroches „Cromwell vor dem Sarg Karls I.“ | 93 | ||
| Léopold Roberts „Schnitter“ als Sozialutopie | 95 | ||
| Vom „Ende der Kunstperiode“ und von der Malerei der Zukunft | 97 | ||
| Bibliographische Notiz | 98 | ||
| VI Théophile Gautier (1811-1872) | 99 | ||
| Der Jünger des Schönen | 99 | ||
| Gautier, Zeichner und Maler | 100 | ||
| Der Kunstkritiker: Journalist und Dichter | 101 | ||
| Ästhetik der Einfühlung: Empathie und das erweiterte Ich | 104 | ||
| Pradier und die göttliche Antike | 108 | ||
| Die Revolte der Bildhauer – ein Dilemma Gautiers? | 113 | ||
| Gautiers rhetorische Strategien | 115 | ||
| Préault und die romantische Skulptur | 118 | ||
| Ingres und die Religion der Form | 122 | ||
| Geheime Vorbehalte: Gautiers Einsatz für den „Abenteurer“ Delacroix | 124 | ||
| Union von Romantik und Klassizismus – Ein Ende der Querelle der Zeichner und Koloristen? | 128 | ||
| Modernität als nostalgische Avantgarde | 131 | ||
| Affinitäten: Gautier und die „Pompiers“ | 135 | ||
| Von der Macht retrospektiver Kunst | 139 | ||
| Ästhetisierende Nekrophilie | 142 | ||
| Der Erzähler Gautier – Vollender der Pompiers? | 144 | ||
| Manets Verstoß gegen die Konventionen | 146 | ||
| Gegen die „Brutalität“ des Impressionismus | 149 | ||
| Gautiers historischer Ort: Zwischen Tradition und Avantgarde | 153 | ||
| Bibliographische Notiz | 156 | ||
| VII Charles Baudelaire (1821-1867) | 157 | ||
| Kapitel 1: Erste Berührungen mit Kunst | 157 | ||
| Kindheit und Jugend | 157 | ||
| Museumsbesuche: Versailles und Nantes | 159 | ||
| Der Sammler Baudelaire und die Verlockung des Kunsthandels | 164 | ||
| Vom Charakter des Kunstkritikers | 166 | ||
| Kapitel 2: Dramatische Anfänge: Der Salon 1845 | 168 | ||
| Die Apotheose Delacroix ’ | 168 | ||
| Ein Fehlurteil: Haussoulliers „Jungbrunnen“ | 169 | ||
| Ästhetik der Überraschung: Decamps | 172 | ||
| Irrwege auf der Suche nach Modernität: Planets „Vision der Hl. Therese“ | 172 | ||
| Kapitel 3: Der Klassizismus: David, seine Schule und Ingres | 175 | ||
| Vom Bazar Bonne-Nouvelle 1846 bis zur Weltausstellung 1855. Davids „Marat“ | 175 | ||
| Ingres, der „französische Raffael“ zwischen Kritik und Anerkennung | 178 | ||
| Kapitel 4 Die kopernikanische Wende: Der „Salon 1846“ und sein Echo | 182 | ||
| Der neue kritische Ansatz | 182 | ||
| Gegen algebraische Kritik: Naivität und Temperament | 184 | ||
| Hasstiraden und mephistophelische Kritik | 187 | ||
| Instinkt, Erinnerung und kalte Ekstase | 188 | ||
| Individualismus und Anarchie | 190 | ||
| Kapitel 5 Romantik und Neubarock – Abkehr von Raffael | 195 | ||
| Problematische Skulptur | 195 | ||
| Malerei gegen Plastik | 196 | ||
| Das Neubarock: Delacroix | 202 | ||
| Phantastisches im Alltäglichen | 205 | ||
| Delacroix und Baudelaire: Persönliche Beziehungen | 207 | ||
| Delacroix: Der Mythos von Grausamkeit und Melancholie | 209 | ||
| Die Fehler des Malers | 211 | ||
| Die Herrschaft der Imagination: Kalkül und Kreation | 211 | ||
| Exkurs: Die Verdammung der Photographie | 215 | ||
| Die Herausforderung des Sujets. Narrative Malerei | 218 | ||
| Legros und die religiöse Genremalerei | 220 | ||
| Assoziative Kunstkritik am Beispiel von Legros | 221 | ||
| Hedonistische Kunstkritik: Von Haussoullier und Henri Baron zu Delacroix’ „Ovid bei den Skythen“ | 223 | ||
| Kapitel 6 Landschaftsmalerei. Von der Synästhesie zur Autonomie der Farbe | 227 | ||
| Baudelaires Traumlandschaften: Romaneskes und Kulissenmalerei | 227 | ||
| Landschaftsmalerei und Mnemotechnik | 228 | ||
| Corots Naivität | 231 | ||
| Rousseau und Daubigny – Die Kontroverse über die freie Faktur | 232 | ||
| Boudins Phantasmagorien | 236 | ||
| Der Protest gegen das Skizzenhafte und den Impressionismus: Malraux contra Baudelaire | 237 | ||
| Molekularchemie, Vitalismus und impressionistische Landschaftsvision | 239 | ||
| Chevreul und Theorien der Vibrativität | 241 | ||
| Das Kriterium musikalischer Farbwirkung | 243 | ||
| Grenzüberschreitung: Physiologisches und Psychisches von Helmholtz zu Laugel | 246 | ||
| Exkurs über Begrifflichkeiten: „impression und sensation“ | 247 | ||
| Von der „Hülle“ oder der Bedeutung des Akzidentellen. Schönheit und Moderne | 247 | ||
| Autonomie von Farbe und Linie: Delacroix’ Fresken in Saint-Sulpice – Öffnung zur gegenstandslosen Kunst? | 249 | ||
| Von der Impression und Vibrativität zur Hieroglyphe: Die Wendung zur Mystik. „Alles Irdische ist nur ein Gleichnis“ | 253 | ||
| Kapitel 7 Phantasmagorien der Moderne | 256 | ||
| Constantin Guys – der Maler des modernen Lebens. Vom Zauber des Hässlichen | 256 | ||
| Die Kokotte als Venus der Moderne | 258 | ||
| Die zwielichtige Schönheit der Pariser Halbwelt – Von Guys zu Edgar Degas | 259 | ||
| Karikatur und Zivilisationskritik | 260 | ||
| Die Moderne als Phantasmagorie und die „Sept Vieillards“ | 264 | ||
| Kapitel 8 Édouard Manet und die Dekadenz | 267 | ||
| Malerei und Dichtung – Fragwürdige Entsprechungen | 267 | ||
| Der „Gitarrenspieler“ und die Suggestivität des Beiwerks | 268 | ||
| „Lola de Valence“ und das Problem der Vereinzelung im Figurenbild | 270 | ||
| „Das Konzert in den Tuilerien“ – die Provokation der „Fleckenmalerei“ | 272 | ||
| Der „Erste in dem Verfall Ihrer Kunst“: Baudelaires Absage an die Malerei des Freundes | 273 | ||
| Bibliographische Notiz | 277 | ||
| Gesamtschau | 279 | ||
| Abbildungsverzeichnis | 285 | ||
| Bibliographie | 289 | ||
| Index | 309 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish