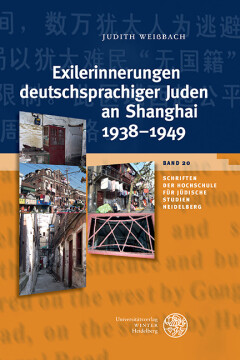
BUCH
Exilerinnerungen deutschsprachiger Juden an Shanghai 1938–1949
Schriften der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg, Bd. 20
2017
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Shanghai, die internationale Hafenmetropole am Chinesischen Meer, bedeutete für deutsche und österreichische Juden, die Ende der 1930er Jahre verzweifelt nach einem Aufnahmeland suchten, sowohl geografisch als auch kulturell das Ende der Welt. Dennoch bot die Stadt zwischen 1938 und 1949 einer der größten deutschsprachigen jüdischen Exilgemeinden Zuflucht vor dem Nationalsozialismus. Die Shanghaier Migrationserfahrung – die Umstände der Aufnahme, die Lebensbedingungen in der besetzten Stadt sowie die Exildauer – stellt eine einzigartige und häufig als „exotisch“ beschriebene Exilerfahrung im Kontext des Zweiten Weltkriegs dar. Die alltagsgeschichtliche Analyse der Flucht- und Exilgeschichten der Shanghaiflüchtlinge, von denen nur ein geringer Teil veröffentlicht wurde, vermittelt tiefe und persönliche Einblicke in die unbekannten Lebenswelten, in denen sich die Shanghaiflüchtlinge behaupten mussten. Mit dem Erinnerungsdiskurs über das Shanghaier Exil wird ein wichtiger Meilenstein in der Überwindung der eurozentrischen Sicht des Zweiten Weltkriegs gesetzt.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | Cover | ||
| Titel | III | ||
| Impressum | IV | ||
| Vorwort | V | ||
| Inhaltsverzeichnis | VII | ||
| Abkürzungsverzeichnis | X | ||
| 1 Einleitung | 1 | ||
| 2 Analyse von Autobiografien: Identität, Erinnerung und Diskurs | 7 | ||
| 2.1 Identität und sozialer Bezugsrahmen | 8 | ||
| 2.2 Erinnerung, Gedächtnis und Diskurs | 12 | ||
| 3 Alltagsgeschichte und Lebenswelt | 15 | ||
| 3.1 Quellensammlung | 19 | ||
| 3.2 Analyse des Diskurses | 19 | ||
| 3.3 Beschaffenheit der Quellen | 21 | ||
| 3.3.1 Egodokumente, Selbstzeugnisse, Erinnerungstexte | 21 | ||
| 3.3.2 Exkurs: Oral History | 25 | ||
| 3.3.3 Abgrenzung und Entwicklung der modernen (jüdischen) Autobiografie | 26 | ||
| 3.3.4 Vergessen, erinnert, (re-) konstruiert: die Herausforderung der Erinnerungstexte | 27 | ||
| 4 Quellen und Diskursentwicklung: 1940er-Jahre bis heute | 31 | ||
| 4.1 Entstehung – Formierung – Pluralisierung – Popularisierung des Diskurses | 33 | ||
| 4.1.1 1940er- und 1950er-Jahre: schweigsame Jahre eines entstehenden Diskurses | 34 | ||
| 4.1.2 Zusammenfassung 1940er- und 1950er-Jahre | 38 | ||
| 4.2 1960er- und 1970er-Jahre: „Are you really interested in my experience?” Formierung des Diskurses | 38 | ||
| 4.2.1 Exilliteratur und Exilforschung | 40 | ||
| 4.2.2 Kranzler’s Japanese, Nazis and Jews: erstes wissenschaftliches Interesse | 42 | ||
| 4.2.3 Jüdische Geschichtsschreibung in China bis 1980 – ‚The Silent Age‘ | 43 | ||
| 4.2.4 Zusammenfassung 1960er- und 1970er-Jahre | 45 | ||
| 4.3 1980er-Jahre: Formung von Erinnerungsgemeinschaften: Pluralisierung des Diskurses | 45 | ||
| 4.3.1 Erste weibliche Perspektive | 46 | ||
| 4.3.2 Shanghai-Geschichten in der DDR | 47 | ||
| 4.3.3 Gemeinsamkeiten der Autorengeneration der 1980er-Jahre | 50 | ||
| 4.3.4 Zusammenfassung 1980er-Jahre | 51 | ||
| 4.4 1990er-Jahre bis heute: Popularisierung des Diskurses | 52 | ||
| 4.4.1 Geerbtes Exil | 57 | ||
| 4.4.2 Exil Shanghai: Stoff, aus dem Romane und Filme sind | 58 | ||
| 4.4.3 Shanghai-Forschung: fernöstliches Narrativ über den Zweiten Weltkrieg | 60 | ||
| 4.4.4 Chinesische Arbeiten über das jüdische Exil: “a symbol of traditional friendship between the Chinese and Jewish people” | 61 | ||
| 4.4.5 Chinesischer Philosemitismus: Lernen vom ‚jüdischen Erfolg‘ | 65 | ||
| 4.4.6 Rickshaw.org – virtuelle Netzwerke der Shanghailänder | 67 | ||
| 4.4.7 Zusammenfassung des Diskurses seit den 1990er-Jahren | 68 | ||
| 4.5 Zusammenfassung des Schreibens und Sprechens über das Exil | 68 | ||
| 5 Lebenswelt und Alltagserinnerungen: Analyse der Erinnerungstexte | 71 | ||
| 5.1 Prolog zu Vertreibung und Exil: 1920er- und 1930er-Jahre | 75 | ||
| 5.1.1 Bürgerliches Leben – jüdisches Milieu | 76 | ||
| 5.1.2 Religiöse Erziehung und Orientierungen | 82 | ||
| 5.1.3 Zusammenfassung | 87 | ||
| 5.2 Hitlers Machtergreifung und antijüdische Gesetzgebung | 89 | ||
| 5.2.1 Schule im Nationalsozialismus: zwischen Diskriminierung und Identitätssuche | 93 | ||
| 5.2.2 Scheidungen, Trennungen und Patchwork: Einwirkungen auf das Familienleben | 97 | ||
| 5.2.3 Zusammenfassung | 100 | ||
| 5.3 Reichspogromnacht und Deportationen: Wendepunkt und Fluchtgedanken | 101 | ||
| 5.3.1 Vorbereitung der Flucht: ”Battling Bureaucracy“ | 106 | ||
| 5.3.2 Zusammenfassung | 118 | ||
| 5.3.3 „Zu den bezopften Messerschluckern und jonglierenden Tellerfritzen?“ Chinabilder und -diskurse vor der Flucht | 119 | ||
| 5.3.4 Unfreiwillige Abenteurer | 125 | ||
| 5.4 Die Flucht: Abschied und Reiserouten | 128 | ||
| 5.4.1 Grenzüberschreitungen und Reisewege | 134 | ||
| 5.4.2 Shanghai-Fahrer: Exilanten, Emigranten, Flüchtlinge, Vertriebene? | 138 | ||
| 5.4.3 Die Schiffsreise: „noch etwas beurlaubt von den Realitäten des Lebens“ | 139 | ||
| 5.5 Ankunft in Shanghai „…as if we had come from a different planet“ | 147 | ||
| 5.5.1 Staatsbürgerschaft, Identität und Zugehörigkeit | 154 | ||
| 5.6 Shanghai – umkämpfte Metropole am Huangpu | 160 | ||
| 5.6.1 Einreisebeschränkungen | 166 | ||
| 5.7 Einrichten im Wartesaal | 170 | ||
| 5.7.1 Heimweh und Nostalgie: Stadtwahrnehmung als Exilerfahrung | 171 | ||
| 5.7.2 Etablierung und Rückzug in eine deutschsprachige Exilwelt: kulturelle Identifikationen im Exil | 175 | ||
| 5.7.3 Deutsche Sprache als zweite Heimat | 181 | ||
| 5.7.4 Juden in Shanghai – Kaleidoskop der Shanghaier Gesellschaft | 184 | ||
| 5.7.5 Heranwachsen in Shanghai | 194 | ||
| 5.7.6 Die Beschränkungen des Ghettos | 204 | ||
| 5.7.7 Hygienediskurs: Sauberkeit und Wohnen | 210 | ||
| 5.7.8 „Die Identitätskrise war schlimmer denn je.“ – Bewältigungsstrategien | 214 | ||
| 5.7.9 Weibliche und männliche Exilwahrnehmung und Bewältigung | 218 | ||
| 5.8 Shanghailänder, Chinesen, Nazis und Japaner in Shanghai | 224 | ||
| 5.8.1 „[E]in Leben nebeneinander gelebt“ – die Wahrnehmung der Chinesen | 224 | ||
| 5.8.2 Westliche Ausländer und jüdische Emigranten: Identifikation und Segregation | 245 | ||
| 5.8.3 Deutsche und Nazis in Shanghai | 249 | ||
| 5.8.4 Getrennte Shanghaier Lebenswelten | 255 | ||
| 5.8.5 Wahrnehmung der Japaner: „Verfolgt aber wurden sie nicht“ | 257 | ||
| 5.8.6 Shanghailänder als retrospektive Selbstbezeichnung | 265 | ||
| 5.8.7 Wartesaal Shanghai | 267 | ||
| 5.9 Kriegsende in Shanghai | 269 | ||
| 5.9.1 Ambivalenter Erinnerungsort: der 17. Juli 1945 und die Befreiung | 270 | ||
| 5.9.2 Amerikanische Befreier | 272 | ||
| 5.9.3 Kriegsende und Kommunistische Revolution in China | 276 | ||
| 5.10 Weiterwanderung | 280 | ||
| 5.10.1 Die Vereinigten Staaten von Amerika | 283 | ||
| 5.10.2 Palästina – Israel | 286 | ||
| 5.10.3 Australien | 287 | ||
| 5.10.4 Weiterwanderung in die Karibik | 289 | ||
| 5.10.5 Remigration in beide Deutschlands und Österreich | 291 | ||
| 5.10.6 Über Shanghai schreiben: Flüchtlinge und HolocaustÜberlebende | 296 | ||
| 6 Ergebnisse der Arbeit | 299 | ||
| 6.1 Herausforderungen und Bewältigungsstrategien: Selfmade- Geschichten | 299 | ||
| 6.2 Entwicklungen und Einflüsse auf die Identität | 301 | ||
| 6.3 Wahrnehmung der Fremde als Spiegel der Selbstwahrnehmung | 302 | ||
| 6.4 Kollektive Erfahrung und gemeinsame Erinnerung | 303 | ||
| Unveröffentlichte Memoiren und Dokumente | 305 | ||
| Literaturverzeichnis | 306 | ||
| Backcover | 321 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish