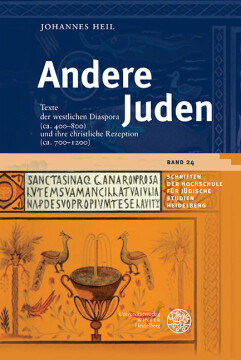
BUCH
Andere Juden
Texte der westlichen Diaspora (ca. 400–800) und ihre christliche Rezeption (ca. 700–1200)
Schriften der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg, Bd. 24
2024
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Die Studie profiliert den westlichen Mittelmeerraum als jüdische Diasporalandschaft eigener Prägung. Der Westen war bis zur Rezeption des rabbinischen Judentums im Hochmittelalter keine Leerstelle. Archäologische und epigraphische Zeugnisse in griechischer und lateinischer, nur zum geringen Teil auch in hebräischer Schrift belegen das eindrücklich. Dem können nun Stücke eines Corpus lateinischer Texte sehr unterschiedlicher Gattungen zur Seite gestellt werden, die infolge der späteren Hebraisierung der Schriftkultur der westlichen Juden nur aus kirchlicher Überlieferung erhalten sind. Sie bergen keinerlei christliche Inhalte und waren Autoren des 9. Jahrhunderts als jüdische Texte bekannt. Damit stellt das Buch die ältere Kulturgeschichte der Diaspora auf eine neue Grundlage und bietet Einsichten zu Fragen nach Selbstverständnissen, Selbstbehauptungen und kultureller Diversität sowie Transformationen in pluralen Gesellschaften.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | III | ||
| Impressum | IV | ||
| Inhalt | V | ||
| ‚Vorwort‘ | XI | ||
| Abkürzungsverzeichnis | XXI | ||
| Teil I: Lebenswelt | 3 | ||
| 1 Andere Juden Spätantike und Frühmittelalter als Forschungsproblem – Traditionen, Theoreme und Evidenz | 3 | ||
| 1.1 Anstöße: Manuskripte in Reims und Saint-Denis, Synagogen in Ostia und Naro | 3 | ||
| 1.2 Annäherungen: Das kulturell-soziale Profil des westmediterranen Judentums | 17 | ||
| 1.3 „Biblische Juden“, „Verfall“ und „normatives Judentum“ | 37 | ||
| 1.4 Diaspora und Diasporaforschung, oder: Die Lebenswelt des Mimen Pylades zwischen Skythopolis und Ostia | 47 | ||
| 1.5 Nation, Volk, Ethnie und/oder Religion – Begriffe und Interpretamente | 70 | ||
| 1.6 Varianzen, Hybridität und Transformationen | 75 | ||
| 1.7 Verzweigungen und Verflechtungen: Das „Parting of the Ways“ und der „Philo-Filter“ | 98 | ||
| 1.8 Die westliche Dimension: Jüdische Spuren in Fulda, Reims und Saint-Denis | 109 | ||
| Teil II: Texte – Corpusspolien | 117 | ||
| 2 Jüdische Traditionen in der karolingerzeitlichen Exegese | 122 | ||
| 2.1 „Hebraei dicunt …“ in Fulda und Auxerre | 129 | ||
| 2.2 Jüdische Traditionen in den karolingerzeitlichen Genesisauslegungen | 134 | ||
| 2.3 Gen 48–50: Die ‚Benedictiones Patriarcharum‘ in der Schule von Auxerre und ihre jüdischen Grundlagen | 149 | ||
| 2.4 Jüdische Traditionen in weiteren Auslegungen | 157 | ||
| 2.5 ‚Dubia‘ – Kommentierte Zusammenstellungen uneindeutiger Belege | 162 | ||
| 2.6 Resumé: Die Begehbarkeit von Toren und Überlieferungsräumen | 186 | ||
| 3 Das mittelalterliche ‚Hieronymianum‘: Hieronymus, Para-Hieronymus und Judeo-Hieronymus | 193 | ||
| 3.1 Textstudien | 200 | ||
| 3.1.1 Hieronymiana | 200 | ||
| 3.1.2 Andere Autorentexte | 202 | ||
| 3.1.3 Para-Hieronymiana | 205 | ||
| 3.1.4 Judeo-Hieronymiana | 215 | ||
| 3.1.4.1 Die Kommentierung der biblischen Geschichtsbücher | 215 | ||
| 3.1.4.1.1 Textmerkmale | 220 | ||
| 3.1.4.1.2 Textvarianzen | 226 | ||
| 3.1.4.1.3 Weitere Beobachtungen zur Integrität des Textes: Judeo-Hieronymus und Rabanus | 251 | ||
| 3.1.4.1.4 Zur Verfasserschaft der Kommentierung der biblischen Geschichtsbücher | 257 | ||
| 3.1.4.2 Weitere Judeo-Hieronymiana: Textmerkmale und Textvarianten | 260 | ||
| 3.1.5 Zusammenfassung | 276 | ||
| 3.1.6 Anhang: Der Text des Habakuk-Kommentars des Judeo-Hieronymus (AP) | 277 | ||
| 3.2 Das ‚Hieronymianum‘: Manuskriptstudien | 282 | ||
| 3.2.1. Die Corpus-Kompositionen des ‚Hieronymianum‘ | 283 | ||
| 3.2.2 Beschreibung wichtiger Codices | 287 | ||
| 3.2.3 Die Corpus-Komposition nach Textsorten | 307 | ||
| 3.2.4 Kodikologische Durchsicht der Texte des ‚Hieronymianum‘ | 308 | ||
| 3.2.4.1 Hieronymiana | 309 | ||
| 3.2.4.2 Andere Autorentexte | 320 | ||
| 3.2.4.3 Para-Hieronymiana | 327 | ||
| 3.2.4.4 Judeo-Hieronymiana | 347 | ||
| 3.2.4.4.1 Die Kommentierung der biblischen Geschichtsbücher: aus dem jüdischen Autor wird (Ps.-)Hieronymus | 347 | ||
| 3.2.4.4.2 Andere Judeo-Hieronymi | 367 | ||
| 3.2.5 Codices-Gruppen | 375 | ||
| 3.2.5.1 Die Gruppe des Moselraums (MG) | 376 | ||
| 3.2.5.2 Die normannisch-englische Gruppe (NE) | 381 | ||
| 3.2.5.3 Die Gruppe des weiteren Alpenraums (GwA) | 385 | ||
| 3.2.5.4 Die kontinentale Sondergruppe (kSG) | 391 | ||
| 3.2.6 Die Corpusgenese des Hieronymianum | 393 | ||
| 3.2.6.1 Von א zu α und β: Ein jüdischer Codex und seine christliche Rezeption | 393 | ||
| 3.2.6.2 Υ und δ: Das Hieronymianum in seiner Entstehung | 397 | ||
| 3.2.7 Tabellen zu Codices, Textbeständen und Positionierungen | 403 | ||
| 3.3 Judeo-Hieronymus: Umrisse einer Verfasserschaft | 410 | ||
| 3.3.1 Judeo-Hieronymus: Annäherungen an eine unfassbare Persönlichkeit | 410 | ||
| 3.3.2 Judeo-Hieronymus: autobiographische Selbstäußerungen | 420 | ||
| 3.3.3 Judeo-Hieronymus: ein Grenzgänger innerhalb des Judentums seiner Zeit | 423 | ||
| 4 Der Liber ‚Antiquitatum Biblicarum‘, Pseudo-Phila, und das Phantom des hebräischen „Urtextes“ | 431 | ||
| 4.1 LAB und die Grenzen kategorialer Zuordnungen | 431 | ||
| 4.2 Stationen der Rezeptionsgeschichte des ‚LAB‘ | 435 | ||
| 4.3 Ein neuer Blick auf den ‚LAB‘ | 442 | ||
| 4.4 Der kulturelle Ort des ‚LAB‘ | 448 | ||
| 4.5 Pseudo-Philo oder Pseudo-Phila? | 451 | ||
| 4.6 Der ‚LAB‘ und die Verheißung des Landes | 454 | ||
| 4.7 Deborahs Lied und die apologetische Dramaturgie des ‚LAB‘ | 455 | ||
| 4.8 Zusammenfassung | 461 | ||
| 5 Die Lex Dei – jüdisches Recht im römischrechtlichen Modus | 465 | ||
| 5.1 Die Lex Dei in christlichem Gebrauch | 470 | ||
| 5.2 Zur Verfasserschaft der Lex Dei | 472 | ||
| 5.3 Die jüdische Lex Dei | 479 | ||
| 5.4 Zur Datierung und Lokalisierung der Lex Dei | 484 | ||
| 5.5 „Leidige Fakultätengrenzen“ (Ernst Lewy), ihre Persistenz und die Halacha der jüdischen Römer | 491 | ||
| 6 Zusammenfassung: Andere Juden, ihre Texte und die Schwierigkeiten, sie als solche zu lesen | 493 | ||
| Teil III: Apparat | 509 | ||
| Bibliographie | 509 | ||
| 1 Quellen | 509 | ||
| 2 Nachschlagewerke | 516 | ||
| 3 Literatur | 520 | ||
| Verzeichnis der zitierten Codices | 589 | ||
| Indices | 595 | ||
| 1 Quellen A: Bibel und bibelnahe Texte | 595 | ||
| 2 Quellen B: Schriften | 597 | ||
| 3 Sachbegriffe | 603 | ||
| 4 Autor:innen sowie biblische und historische Personen | 609 | ||
| 5 Moderne Autor:innen | 613 | ||
| 6 Orte/Landschaften | 615 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish