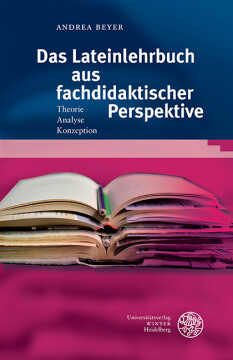
BUCH
Das Lateinlehrbuch aus fachdidaktischer Perspektive
Theorie – Analyse – Konzeption
Sprachwissenschaftliche Studienbücher. 1. Abteilung
2019
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Wie sind Lateinlehrbücher strukturiert? Erfüllen sie ihre Funktion? Berücksichtigen sie die fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Konzepte, um ihrer Rolle als Leitmedium des Lateinunterrichts gerecht zu werden? Diesen wie auch weiteren Fragen wird im vorliegenden Buch nachgegangen, indem im Sinne der ‚mixed methods‘-Strategie theoretische Forschung und empirische Analysemethoden kombiniert werden. Auf der Basis der komplexen Ergebnisse wird eine Theorie entworfen, wie (Latein-)Lehrbücher konzipiert werden sollten, um ihrem Stellenwert besser gerecht zu werden. Ergänzt wird diese Theorie durch eine Handreichung, die konkrete Vorschläge zur Konzeption der wesentlichen Strukturelemente eines Lateinbuches anbietet. Da die entworfene „Lehrbuchtheorie“ auch überfachlich anwendbar erscheint, richtet sich dieses Buch an Lehrbuchentwickler, Didaktiker, Lehrer sowie an alle, die sich mit der Erstellung von Lehrmaterialien befassen.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | C | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| 1 Vorwort | 5 | ||
| 2 Einleitung | 13 | ||
| 3 Teil I: Theoretische Grundlagen | 17 | ||
| 3.1 Das Lehrbuch | 20 | ||
| 3.1.1 Das Lehrbuch – eine Standortbestimmung | 21 | ||
| 3.1.2 Das Lehrbuch im Lateinunterricht | 42 | ||
| 3.2 Texte | 67 | ||
| 3.2.1 Eine kurze Terminologie zur Sprache | 67 | ||
| 3.2.2 Die (wichtigsten) sprachlichen Kompetenzen | 91 | ||
| 3.3 Aufgaben | 166 | ||
| 3.3.1 Aufgaben – eine Standortbestimmung | 166 | ||
| 3.3.2 Aufgaben und Übungen im Lateinunterricht | 186 | ||
| 4 Teil II: Forschungsdesign | 193 | ||
| 4.1 Dokumentenanalyse und Datenerhebung | 194 | ||
| 4.1.1 Die Lateinlehrbücher: Materialauswahl | 194 | ||
| 4.1.2 Texte: Textkomplexität | 197 | ||
| 4.1.3 Aufgaben: Aufgabenkomplexität | 231 | ||
| 4.2 Datenerhebung mittels Befragung der Lehrbuchnutzer | 232 | ||
| 4.2.1 Vorbereitung der Umfrage | 232 | ||
| 4.2.2 Durchführung der Umfrage | 235 | ||
| 4.2.3 Auswertung der Umfrage | 236 | ||
| 4.3 Darstellung der Daten aus Lehrbuchanalyse und Umfrage | 238 | ||
| 4.3.1 Allgemein bekannte Diagrammtypen | 238 | ||
| 4.3.2 Spezielle Diagrammtypen | 243 | ||
| 5 Teil III: Darstellung der Ergebnisse | 249 | ||
| 5.1 Ein Beispiel der Lehrbuchanalyse: ROMA (2016) | 250 | ||
| 5.1.1 Texte | 251 | ||
| 5.1.2 Aufgaben resp. Übungen | 257 | ||
| 5.2 Befragung der Nutzer | 259 | ||
| 5.2.1 Lernende | 260 | ||
| 5.2.2 Lehrende | 270 | ||
| 6 Teil IV: Auswertung der Ergebnisse | 275 | ||
| 6.1 Die Lehrbücher im Vergleich | 276 | ||
| 6.1.1 Texte | 276 | ||
| 6.1.2 Aufgaben resp. Übungen | 299 | ||
| 6.2 Die Sicht der Nutzer | 307 | ||
| 6.2.1 Texte | 307 | ||
| 6.2.2 Aufgaben resp. Übungen | 315 | ||
| 6.2.3 Sonstiges (Visualisierungen, Design) | 317 | ||
| 6.3 Zusammenfassung und Problematisierung | 318 | ||
| 7 Teil V: Schlussfolgerungen | 321 | ||
| 7.1 Voraussetzungen für die Konzeption von Lateinlehrbüchern | 322 | ||
| 7.1.1 Marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen | 324 | ||
| 7.1.2 (Schul-)politische Vorgaben | 325 | ||
| 7.1.3 Fachspezifische Anforderungen (Latein) | 326 | ||
| 7.2 Theorie der Konzeption von Lateinlehrbüchern | 331 | ||
| 7.2.1 Zentrale Bestandteile eines Lateinlehrbuches | 331 | ||
| 7.2.2 Strukturierung eines Lateinlehrbuches | 338 | ||
| 7.2.3 Qualitätskriterien der Entwicklung eines Lateinlehrbuches | 348 | ||
| 7.2.4 Zusammenfassung: Ist ‚Lehrbuchkompetenz‘ die Antwort | 357 | ||
| 7.3 Handreichung zur Konzeption von Lateinlehrbüchern | 360 | ||
| 7.3.1 Ebenenspezifische Qualitätsstandards | 360 | ||
| 7.3.2 Lehrbuchübergreifende Qualitätsstandards | 371 | ||
| 7.4 Ausblick: Bedeutung dieser Arbeit für zukünftige Lehrbücher | 376 | ||
| 8 Literaturverzeichnis | 381 | ||
| 8.1 Aufgaben und Übungen | 381 | ||
| 8.2 Grundlagenliteratur | 383 | ||
| 8.3 Kompetenzen | 387 | ||
| 8.4 Lateinunterricht und Latein | 394 | ||
| 8.5 Lehrbücher und Lehrwerke | 399 | ||
| 8.6 Lehrbuchtheorie | 400 | ||
| 8.7 Terminologie zur Sprache | 403 | ||
| 9 Anhang | 407 | ||
| 9.1 Qualitätsstandards von Lehrwerken und Lehrbüchern | 407 | ||
| 9.1.1 Qualitätsstandards für Lehrwerke | 407 | ||
| 9.1.2 Qualitätsstandards für Lehrbücher | 407 | ||
| 9.1.3 Qualitätsstandards für elektronische Komponenten | 410 | ||
| 9.2 Aufgabentypen der Lehrbücher | 411 | ||
| 9.3 Übersicht: Sprachfaktor des Koeffizienten | 412 | ||
| 9.4 Wichtige syntaktische Erscheinungen in den Lehrbüchern | 414 | ||
| 9.5 Stichprobe Originalliteratur – Textmerkmale | 416 | ||
| 9.6 Lehrbuchanalyse: Textlänge und Lesbarkeit | 418 | ||
| Abbildungsverzeichnis | 8 | ||
| Abb. 1 Stellung des Lehrbuchs | 33 | ||
| Abb. 2 4-Quadrantenmodell von Cummins | 69 | ||
| Abb. 3 Doppeleisbergmodell und CUP nach Cummins | 70 | ||
| Abb. 4 Die Mittlerstellung der Standardsprache | 86 | ||
| Abb. 5 Modell zur „Sprachkompetenz“ | 90 | ||
| Abb. 6 Lernkompetenzmodell-Modell | 96 | ||
| Abb. 7 Ein integratives Übersetzungsmodell | 143 | ||
| Abb. 8 Teilkompetenzen der Übersetzungskompetenz | 147 | ||
| Abb. 9 Translationskompetenz im Lateinunterricht | 158 | ||
| Abb. 10 4-Ebenen-Modell der sprachlichen Kompetenzen | 160 | ||
| Abb. 11 Ein neues Kompetenzmodell für den Lateinunterricht | 165 | ||
| Abb. 12 Instrument zur Einschätzung von Lernaufgaben | 176 | ||
| Abb. 13 Die Phasen einer Lernaufgabe | 177 | ||
| Abb. 14 Köhlers Regelkreis | 204 | ||
| Abb. 15 Beispielauswertung Textanalyse-Tool | 212 | ||
| Abb. 16 Beispiel Liniendiagramm | 239 | ||
| Abb. 17 Beispiel Säulendiagramm | 240 | ||
| Abb. 18 Beispiel Balkendiagramm | 241 | ||
| Abb. 19 Beispiel gruppiertes Säulendiagramm | 241 | ||
| Abb. 20 Beispiel Kuchendiagramm | 242 | ||
| Abb. 21 Beispiel Boxplot | 244 | ||
| Abb. 22 Beispiel Pivot-Diagramm | 246 | ||
| Abb. 23 Beispiel Pareto-Diagramm | 247 | ||
| Abb. 24 Lesbarkeitsergebnisse dt. Sachtexte (ROMA) | 251 | ||
| Abb. 25 Textlänge und Anzahl der Sätze (ROMA) | 252 | ||
| Abb. 26 Satzlängen der lat. Texte (ROMA) | 253 | ||
| Abb. 27 Häufigkeitsverteilung der Satzlängen (ROMA) | 253 | ||
| Abb. 28 Anzahl der syntaktischer Erscheinungen (ROMA) | 254 | ||
| Abb. 29 Häufigkeitsverteilung der Infinitive (ROMA) | 255 | ||
| Abb. 30 Häufigkeitsverteilung der nd-Formen / Supina (ROMA) | 255 | ||
| Abb. 31 Häufigkeitsverteilung der Nebensätze (ROMA) | 256 | ||
| Abb. 32 Häufigkeitsverteilung der Einzelphänomene (ROMA) | 256 | ||
| Abb. 33 Häufigkeitsverteilung der Modi im HS (ROMA) | 256 | ||
| Abb. 34 Häufigkeitsverteilung der Partizipien (ROMA) | 257 | ||
| Abb. 35 Anzahl der Operatoren pro Lektion (ROMA) | 257 | ||
| Abb. 36 Verteilung der Operatoren auf die AFB (ROMA) | 257 | ||
| Abb. 37 Absolute Häufigkeiten der Operatoren (ROMA) | 258 | ||
| Abb. 38 Anteil der Aufgaben pro Kompetenzstufe (ROMA) | 258 | ||
| Abb. 39 Warum wurde das Fach Latein gewählt? | 262 | ||
| Abb. 40 Wie wird das eigene Lateinbuch eingeschätzt? | 263 | ||
| Abb. 41 Was ist an Latein schwer? | 265 | ||
| Abb. 42 Vergleich der durchschnittlichen Lesbarkeitsergebnisse | 276 | ||
| Abb. 43 Abweichungen von der jeweiligen Sollklassenstufe | 278 | ||
| Abb. 44 Gemittelte quantitative Werte der lat. Texte | 286 | ||
| Abb. 45 Durchschnittliche Anzahl der Wörter und Sätze der lat. Texte | 287 | ||
| Abb. 46 Anzahl der Wörter und Sätze in Originaltextauszügen | 287 | ||
| Abb. 47 Durchschnittliche Satzlängenwerte der Lehrbücher | 289 | ||
| Abb. 48 Häufigkeitsverteilung kurzer Sätze in den Lehrbüchern | 290 | ||
| Abb. 49 Häufigkeitsverteilung der Satzlängen in den Lehrbüchern | 290 | ||
| Abb. 50 Satzlängenwerte für Cicero-Textauszüge | 291 | ||
| Abb. 51 Gemittelte quantitative Werte der Cicero-Textauszüge | 291 | ||
| Abb. 52 Häufigkeitsverteilung der Satzlängen in den Cicero-Auszügen | 292 | ||
| Abb. 53 Anteil syntaktischer Erscheinungen in den Lehrbüchern | 292 | ||
| Abb. 54 Entwicklung der Textkomplexität in den Lateinbüchern | 296 | ||
| Abb. 55 Textkomplexität der Cicero-Auszüge | 296 | ||
| Abb. 56 Textkomplexität pro Lehrbuch | 297 | ||
| Abb. 57 Häufigkeitsverteilung der Operatoren in den Lateinbüchern | 302 | ||
| Abb. 58 Häufigkeitsverteilung der Aufgabentypen pro Kompetenzstufe | 303 | ||
| Abb. 59 Dominante Aufgabenformate der Lateinlehrbücher | 304 | ||
| Abb. 60 Die Verständlichkeit der Sachtexte | 309 | ||
| Abb. 61 Bereiten die Übersetzungstexte auf die Originallektüre vor? | 310 | ||
| Abb. 62 Wie sollte das Übersetzen geübt werden? | 311 | ||
| Abb. 63 Wie schwer sind die Übersetzungstexte? | 313 | ||
| Abb. 64 Einflussgrößen auf die Entwicklung eines Lateinlehrbuches | 323 | ||
| Abb. 65 Der Baustein Text eines Lateinlehrbuches | 332 | ||
| Abb. 66 Der Baustein Aufgabe eines Lateinlehrbuches | 333 | ||
| Abb. 67 Der Baustein Visualisierung eines Lateinlehrbuches | 334 | ||
| Abb. 68 Das didaktische Kernelement | 335 | ||
| Abb. 69 Das ‚konzeptionelles Dreieck‘ | 336 | ||
| Abb. 70 Struktur eines Lehrbuches | 338 | ||
| Abb. 71 Lineare Anordnung der Bausteine | 340 | ||
| Abb. 72 Die didaktischen Kernelemente in Netzstrukturvarianten | 341 | ||
| Abb. 73 Der strukturelle Grundriss eines Lateinlehrbuches | 358 | ||
| Abb. 74 Qualitätskategorien der Nanoebene, Baustein dt. Text | 360 | ||
| Abb. 75 Qualitätskategorien der Nanoebene, Baustein lat. Text | 361 | ||
| Abb. 76 Qualitätskategorien der Nanoebene, Baustein Aufgabe | 365 | ||
| Abb. 77 Qualitätskategorien der Nanoebene, Baustein Visualisierung | 367 | ||
| Abb. 78 Qualitätskategorien der Mikroebene | 368 | ||
| Abb. 79 Qualitätskategorien der Mesoebene | 369 | ||
| Abb. 80 Qualitätskategorien der Makroebene | 370 | ||
| Abb. 81 Fachunabhängige Qualitätskategorien (Lernender) | 371 | ||
| Abb. 82 Fachunabhängige Qualitätskategorien (Schulpolitik) | 372 | ||
| Abb. 83 Allgemeine, fachbezogene Qualitätskategorien | 372 | ||
| Abb. 84 Fachdidaktische Qualitätskategorien | 373 | ||
| Abb. 85 Fachmethodische Qualitätskategorien | 375 | ||
| Verzeichnis der Tabellen | 10 | ||
| Tab. 1 Strukturelle und organisatorische Komponenten | 25 | ||
| Tab. 2 Synopse der Makrostruktur | 26 | ||
| Tab. 3 Synopse der Mesostruktur | 27 | ||
| Tab. 4 Synopse der Mikrostruktur | 28 | ||
| Tab. 5 Standards und Neuerungen der 4. Lehrbuchgeneration | 50 | ||
| Tab. 6 Berechnung des Arbeitsumfanges pro Buch | 51 | ||
| Tab. 7 Standards und Neuerungen der 5. Lehrbuchgeneration | 52 | ||
| Tab. 8 Mögliche Standards und Neuerungen einer 6. Lehrbuchgeneration | 54 | ||
| Tab. 9 Synopse zur Makrostruktur der untersuchten Lateinlehrbücher | 56 | ||
| Tab. 10 Synopse zur Mesostruktur der untersuchten Lateinlehrbücher | 57 | ||
| Tab. 11 Synopse zur Mikrostruktur der untersuchten Lateinlehrbücher | 58 | ||
| Tab. 12 Allgemeine und spezifische sprachliche Wahlmöglichkeiten | 73 | ||
| Tab. 13 Konzeptueller Rahmen zur Beschreibung von ‚academic English‘ | 76 | ||
| Tab. 14 Die Merkmale von Bildungssprache nach Reich | 79 | ||
| Tab. 15 Zusammenfassung wesentlicher ‚standardsprachlicher‘ Merkmale | 88 | ||
| Tab. 16 Wesentliche Aspekte der Sprachkompetenz | 103 | ||
| Tab. 17 Textkompetenz im Lateinunterricht | 117 | ||
| Tab. 18 Übersetzungsmodelle | 131 | ||
| Tab. 19 Die Übersetzungstypen | 138 | ||
| Tab. 20 Kompetenzunterschiede bei Übersetzern | 157 | ||
| Tab. 21 Zentrale Merkmale der sprachlichen Kompetenzen | 162 | ||
| Tab. 22 Unterschiede zwischen Lern- und Leistungsaufgaben | 175 | ||
| Tab. 23 Kategorien einer allgemeindidaktischen Aufgabenanalyse | 181 | ||
| Tab. 24 Zuordnung der Operatoren zu einem Anforderungsbereich | 185 | ||
| Tab. 25 Übungen als Bestandteile von Aufgaben | 191 | ||
| Tab. 26 Übersicht zur Einschätzung der Lesbarkeit | 207 | ||
| Tab. 27 Deutsche Flesch-Werte und ihre Bedeutung | 212 | ||
| Tab. 28 Spezifika der lateinischen und deutschen Sprache | 215 | ||
| Tab. 29 Der Schwierigkeitsgrad lateinischer Texte nach Bayer | 220 | ||
| Tab. 30 Syntaktische Erscheinungen und berechnete Koeffizienten | 223 | ||
| Tab. 31 Einführungszeitpunkt syntaktischer Erscheinungen (ROMA) | 254 | ||
| Tab. 32 Anzahl der Nutzer pro genutztes Lateinlehrbuch | 260 | ||
| Tab. 33 Was ist das Beste am eigenen Lateinbuch? | 263 | ||
| Tab. 34 Welche Aufgabentypen sind besonders beliebt? | 267 | ||
| Tab. 35 Textsorten der lat. Übersetzungstexte | 284 | ||
| Tab. 36 Vorkommen syntaktischer Erscheinungen | 293 | ||
| Tab. 37 Vorkommen differenter syntaktischer Erscheinungen | 294 | ||
| Tab. 38 Übersetzungstexte und die Individuelle Sprachkompetenz | 299 | ||
| Tab. 39 Anzahl der Operatoren und Aufgaben | 300 | ||
| Tab. 40 Fachspezifische Inhalte | 329 | ||
| Tab. 41 Elemente jeder Lektion eines Lateinlehrbuches | 343 | ||
| Tab. 42 Elemente jeder Sequenz eines Lateinlehrbuches | 344 | ||
| Tab. 43 Elemente zu Beginn und Ende eines Lateinlehrbuches | 347 | ||
| Tab. 44 Einführungszeitpunkt zentraler syntaktischer Erscheinungen | 415 | ||
| Backcover | 420 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish