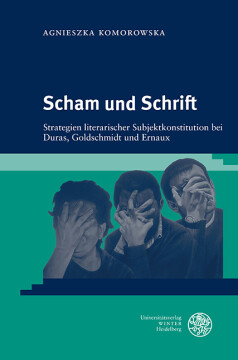
BUCH
Scham und Schrift
Strategien literarischer Subjektkonstitution bei Duras, Goldschmidt und Ernaux
Studia Romanica, Bd. 191
2017
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Das Gefühl der Scham mag angesichts feuilletonistischer Beschwerden über die Schamlosigkeit der zeitgenössischen Literatur als überholtes Phänomen gelten. Die Studie argumentiert hingegen, dass sich im Rahmen des ‚retour du récit‘ in der französischen Literatur seit den 1970er Jahren ein Strang literarischen Erzählens ausbildet, in dem die Scham zum Brennglas für zeitgenössische Umbrüche wird. Dies geschieht zum einen in Rückbindung an innerliterarische Veränderungen, zum anderen in Bezug auf historische Ereignisse, in denen sich das Subjekt mit einer spezifisch nachmodernen Scham konfrontiert sieht. Hierzu gehören das Erbe der Shoah, die Kolonialgeschichte und Beschämungen spätkapitalistischer Lebenswelten. Unter dem Begriff der ‚hontofiction‘ werden Erzählungen von Marguerite Duras, Georges-Arthur Goldschmidt und Annie Ernaux untersucht. Das Subjekt, das u.a. vom ‚nouveau roman‘ zu Grabe getragen wurde, kehrt hier nicht als ein ‚starkes‘ Subjekt zurück, sondern reflektiert in der Art seiner Rückkehr die eigene Brüchigkeit.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | Cover | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Danksagung | 5 | ||
| Inhalt | 7 | ||
| Einleitung | 9 | ||
| 1 Schamtheorien. Schreibweisen einer „hontologie“ | 37 | ||
| 1.1 Gefühlsbegriffe, Schambegriffe | 37 | ||
| 1.2 Theorie der Scham | 42 | ||
| 1.2.1 „ce sentiment aigu d’être rivé“ – Philosophie der Scham | 42 | ||
| 1.2.2 Verdrängen, Begehren, Maskieren. Semantik der Scham in der Psychoanalyse | 54 | ||
| 1.3 Soziologie der Scham. Internalisierung gesellschaftlicher Macht | 67 | ||
| 2 Marguerite Duras. Strategien autofiktionalen Schreibens zwischen "honte, pudeur" und "impudeur" | 79 | ||
| 2.1 „un sens aussi aigu de l’impudeur du langage“ – Eine Poetik des Sprechens in "Les Cahiers de la guerre" | 83 | ||
| 2.1.1 Sprache, Körper und Gewalt | 84 | ||
| 2.1.2 "Parole pudique": Das Verbot des „bavardage“ und seine Transgressionen | 89 | ||
| 2.1.3 Die "poésie d’injures": Von der „hate speech“ zur mystischen Dichtung | 92 | ||
| 2.2 Von der Scham zum Begehren (und zurück) – Umbesetzung von Gefühlen in "L’Amant" | 101 | ||
| 2.2.1 Die zwei Bilder des Mädchens als „équivoque incarnée“ | 103 | ||
| 2.2.2 Blick, Scham, Begehren | 107 | ||
| 2.2.3 Schreiben und Begehren: Subjektkonstitution als Schriftstellerin | 112 | ||
| 2.3 „Le mot ‚écrit‘ ne conviendrait pas.“ – Strategien autofiktionalen Schreibens zwischen Scham und Schamlosigkeit in "La douleur" | 114 | ||
| 2.3.1 Beschwörungsformeln und emotionaler Pakt | 115 | ||
| 2.3.2 Die Diskrepanz zwischen Körper und Stimme | 121 | ||
| 2.3.3 Autofiktion und Zeugenschaft bzw. Scham im Schatten der Shoah | 125 | ||
| 3 Georges-Arthur Goldschmidt. Räume der Scham und die „ruse“ des bestraften Narziss | 133 | ||
| 3.1 "Le miroir quotidien": Versteck und Spur als Leib-Räumlichkeit von Angst und Scham | 138 | ||
| 3.1.1 Scham und Versteck: Unheimliche Bilder der Shoah | 141 | ||
| 3.1.2 Spurensuche und Erinnerung | 146 | ||
| 3.1.3 Das Unheimliche der Scham | 151 | ||
| 3.2 "Un jardin en Allemagne": Die Urszene der Scham | 156 | ||
| 3.2.1 Vater, Mutter, Kind: Scham, Schaulust und Blickverbot im Familienroman | 158 | ||
| 3.2.2 Bühne und Bild | 167 | ||
| 3.2.3 Die Disziplinierung des Kindes | 171 | ||
| 3.2.4 Scham und Schuld | 173 | ||
| 3.3 "La forêt interrompue": Strategien der Beschämung und die Widerständigkeit des Subjekts | 176 | ||
| 3.3.1 Das Theater der Bestrafung | 178 | ||
| 3.3.2 Das Subjekt der Beschämung oder der Triumph des bestraften Narziss | 184 | ||
| 4 Annie Ernaux. Objektivierungsstrategien und soziale Scham | 191 | ||
| 4.1 Schmutziges Sprechen in "Les armoires vides" | 196 | ||
| 4.1.1 Scham und Schmutz. Diskurse sexueller und sozialer "saleté" und Ansteckung | 200 | ||
| 4.1.2 Im Affekt: Hass, Scham und sprachliche Gewalt | 207 | ||
| 4.1.3 „sans affects exprimés“ – Von der „hate speech“ zur „écriture plate“ | 211 | ||
| 4.2 "La honte" – autoethnographisches Projekt und objektive Darstellung der Scham | 215 | ||
| 4.2.1 Noch eine Urszene: Wiederholung und Verschiebung | 217 | ||
| 4.2.2 Raumsoziologie und Ethnographie der Scham | 223 | ||
| 4.2.3 Scham und Autorschaft | 231 | ||
| 4.3 "Les années" – Der kollektive Roman und die Kulturgeschichte der Scham | 237 | ||
| 4.3.1 Eine Gefühls- und Kulturgeschichte Frankreichs seit der Nachkriegszeit | 239 | ||
| 4.3.2 Das Verhältnis von individueller und kollektiver Scham | 253 | ||
| 5 Schlussbetrachtungen | 259 | ||
| 6 Literaturverzeichnis | 267 | ||
| Backcover | 286 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish