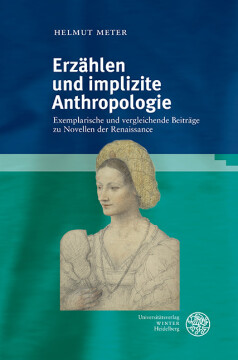
BUCH
Erzählen und implizite Anthropologie
Exemplarische und vergleichende Beiträge zu Novellen der Renaissance
Studia Romanica, Bd. 214
2019
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Die Beiträge des Buches widmen sich romanischen Novellen aus Spätmittelalter und Renaissance und sind der übergeordneten Frage nach einem neuen Menschenbild in diesen verpflichtet. Dabei richtet sich das Erkenntnisinteresse auf eine erzählimmanente Anthropologie, deren Konturen zum Teil über den literarischen Vergleich verdeutlicht werden. Da die Renaissance einen Umbruch kultureller Gewissheiten mit sich bringt, erweist sich die narrative Suche nach dem, was den Menschen angesichts seines Denkens und Tuns essentiell ausmachen soll, als zentral. Eine Epoche, die für die Neuorientierung des reflexiven und sinnlichen Zugangs zur Welt steht, kann indes nur bedingt bereits gefestigte Anschauungen neugefasster humaner Identität bereitstellen. Das Erproben unterschiedlicher Ansätze dominiert. Für ein solches Vorgehen ist das Genre der Novelle als ein damals noch relativ offenes sehr geeignet. Boccaccio, Bandello und Marguerite de Navarre bilden den Kern der Betrachtungen.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhalt | 5 | ||
| Vorwort | 11 | ||
| 1 Einleitung. Im Vorhof der Anthropologie – Menschenbilder in der Renaissancenovelle | 13 | ||
| 1.1 Implizite Auffassungen vom Menschen in der Renaissancenovelle | 13 | ||
| 1.2 Das heterogene Bemühen um eine Basis menschlicher Eigenschaften | 15 | ||
| 1.3 Fiktionale Charakteristika des Humanen | 19 | ||
| 1.4 Der Nexus von Erzählweise und erzählter Anthropologie | 21 | ||
| 1.5 Textinterpretation als Verfügbarmachen von Sinnhorizonten | 24 | ||
| 2 Timonedas „patraña octava“ und der achtundzwanzigste Gesang des „Orlando Furioso“. Ein Aspekt des Imports der Renaissancenovelle in Spanien | 27 | ||
| 2.1 Timonedas „El Patrañuelo“ als Sammelbecken italienischer Renaissancenovellen und die Sonderstellung der „patraña octava“ als Prosafassung einer Versnovelle aus dem „Orlando Furioso“ | 27 | ||
| 2.2 Die Gegenüberstellung beider Erzählfabeln und die unterschiedliche Beurteilung weiblicher Untreue: Ariosts Bemühen um anthropologische Erkenntnis im Unterschied zu Timonedas normativem Moralverständnis | 29 | ||
| 2.3 Die Erkundungsreise der Freundespaare weiblicher Standhaftigkeit in Fragen der Liebe: zu Ariosts wertneutraler Feststellung des Fehlens von Treue und Keuschheit der Frauen und Timonedas misogyner Denunziation des untreuen ,weiblichen Geschlechts‘ | 34 | ||
| 2.4 Die narrativen Schlusspartien und die differentielle Qualität beider Versionen: zur konstitutionell gegebenen Untreue der Frauen als selbstironisch zu akzeptierendem Faktum bei Ariost und als Gegenstand von Ranküne geprägter „dissimulatio“ bei Timoneda | 37 | ||
| 2.5 Zum signifikanten Unterschied der Novellenfassungen: der Hiat von Kongruenz der Handlungsmuster und Divergenz der Semantiken. Exempel-Tradition und didaktisch bestimmte Antinomie der Texte | 40 | ||
| 3 Von der Renaissancenovelle zu Elementen einer „scientia sexualis“: Brantômes „Dames galantes“ | 45 | ||
| 3.1 Die „Dames galantes“ als Mischgenre und der sie bestimmende Kommunikationscode der Sexualität | 45 | ||
| 3.2 Brantômes Technik der semantischen Umpolung von Basistexten der italienischen Renaissance: zum Beanspruchen anerkannter Autoren für eigene Ideologeme anhand von Aretinos „Sonetti lussuriosi“ und Ariosts „Orlando Furioso“ (Gesänge XLII, XLIII und IV) | 48 | ||
| 3.3 Die subversive Metamorphose von Bandellos Novelle II,44 und die subtile Umgestaltung von Boccaccios Alatiel-Figur („Decameron“ II,7): zur erotisch unersättlichen Frau als obsessiver Denkfigur bei Brantôme | 53 | ||
| 3.4 Von der sozialethischen Grundlage des Originals zum sensualistischen Plädoyer: die trügerische Intertextualität im Anverwandeln einer Kernszene aus Boccaccios „Filocolo“. Zur Inszenierung einer konstitutionellen luxuria der Frauen | 56 | ||
| 3.5 Das Bemühen um eine anthropologische Klassifikation sexuellen Verhaltens. Moralisierender Habitus im Erzählgestus und Anzeichen von Affektmodellierung | 60 | ||
| 4 Boccaccio in modernem Gewand. Aldo Busis „Decamerone. Da un italiano all’altro“ | 63 | ||
| 4.1 Das „Decamerone“ und Busis Intention der Übertragung von Boccaccios Novellarium in einen funktionsadäquaten zeitgenössischen Text | 63 | ||
| 4.2 Die Verfremdung der mittelalterlichen Welt durch eine aktualitätsbestimmte Semantik und Syntax: Wie das historisch Vergangene an das Hier und Jetzt assimiliert wird („Decameron“ IX,3; X,9) | 65 | ||
| 4.3 Die ideologische Umpolung des Originals im mikrokontextuellen Bereich: zur Abwandlung des signifikanten Details sowie zu dessen Unterschlagung („Decameron“ X,9; VI,2; II,2) | 68 | ||
| 4.4 Die Auflösung der Alterität von Boccaccios Welt in einer ahistorischen Anthropologie | 72 | ||
| 5 Die ritualisierte „beffa“. Boccaccios Calandrino-Novellen | 75 | ||
| 5.1 Calandrino als gesellschaftlicher Außenseiter und die Frage nach seiner sozialpsychologischen Einbettung in den jeweiligen Novellen | 75 | ||
| 5.2 Die iterative Dimension von Calandrinos Fehlverhalten: das disharmonische Zusammentreffen alter und neuer Persönlichkeitsmerkmale im Typus des Sonderlings | 77 | ||
| 5.3 Die Calandrino-Thematik aus der Sicht der „lieta brigata“: ein exemplarisches Modell der Suche nach „festa e buon tempo“ im Rahmen rituellen Erzählens | 81 | ||
| 5.4 Dantes Kritik der „gente nuova“ und Boccaccios Kategorie der „nuove genti“: das Fehlen urbaner Mentalität als Grundlage eines bizarren Habitus und die idealtypische Festigung von „Interaktionsmoral“ und „Interaktionssemantik“ (N. Luhmann) anhand Calandrinos durch die Figuren aus der florentinischen Oberschicht | 86 | ||
| 5.5 Das kalkulierte Erzeugen von Komik mit Hilfe der Calandrino-Novellen als idealem Gegenstand zur Entwicklung einer Erzähl- und Lachkultur | 90 | ||
| 6 Le lettere dedicatorie delle novelle di Bandello: ragionamento moralistico e disposizione ricettiva | 93 | ||
| 6.1 La natura polimorfa della novellistica bandelliana: le lettere dedicatorie come mezzo strategico della psicologia narrativa | 93 | ||
| 6.2 La riduzione del divario formale tra lettera dedicatoria e racconto: la lettera può diventare novella, la novella cangia più volte in testo moralistico | 94 | ||
| 6.3 Bandello in veste autofinzionale al centro dei circoli aristocratici delle lettere dedicatorie: da tradizionale atto di riverenza la lettera si trasforma in un testo di importanza basilare | 99 | ||
| 6.4 Il «compasso della ragione» come „leitmotiv“ delle lettere dedicatorie e l’interesse antropologico di Bandello | 101 | ||
| 6.5 La lettera dedicatoria come crocevia di opinioni discordi: il quadro di una decifrazione polisemica del mondo e di una antropologia della diversità umana | 103 | ||
| 6.6 Le lettere di dedica e la predisposizione dei lettori a una comunanza di pensiero | 105 | ||
| 7 Über das Versagen der Vernunft vor den Affekten. Anthropologische Aspekte in zwei Renaissancenovellen (Marguerite de Navarre: „L’Heptaméron“, 23 / Matteo Bandello: „Novelle“ II,24) | 107 | ||
| 7.1 Das experimentelle Erkunden anthropologischer Grundfragen in beiden Novellen: eine Revision tradierter Auffassungen des Humanen | 107 | ||
| 7.2 Die Erzählfabeln und ihre immanente Kommentierung: Marguerites moralistisches Plädoyer für die Vernunft und gegen die widervernünftigen Affekte – Bandellos Inszenierung von Vernunft als zweckorientiertem Mittel im Dienste der Affekte | 109 | ||
| 7.3 Der Hiat von moralisierendem Kommentar und narrativ suggeriertem Reiz des Unmoralischen bei Bandello: zum Schwinden eines homologen Verhältnisses von Vernunft und Moral | 112 | ||
| 7.4 Die uneinheitliche Anthropologie von Marguerite: Das genuin Narrative des negativen Beispiels überragt „de facto“ die moralistische Argumentation im Zeichen ideellen Vernunftglaubens | 114 | ||
| 7.5 Ein ungelöstes Problem beider Texte: die fragliche Existenz von Willensfreiheit angesichts der anthropologischen Grundausstattung der Menschen | 115 | ||
| 8 Imitazione e ideologia. „La Chastelaine de Vergi“ riscritta da Margherita di Navarra e da Bandello | 117 | ||
| 8.1 Le imitazioni della „Chastelaine de Vergi“ come spostamento del suo messaggio ideologico e proposta di una antropologia diversa: il superamento dell’ „episteme“ medievale | 117 | ||
| 8.2 La trama della „Chastelaine“: lo iato distruttivo tra le leggi della „fin’amors“ e le regole feudali | 118 | ||
| 8.3 La riscrittura di Marguerite de Navarre: il problema di una antropologia malsicura e la messa in discussione del concetto e valore dell’amore stesso | 122 | ||
| 8.4 La riscrittura di Bandello: una visione scettica della «natura» umana e l’invito alla moderazione delle passioni amorose al servizio della convivenza civile | 126 | ||
| 8.5 L’imitazione di un’opera come l’avvio di un discorso di stima indiretto | 129 | ||
| 9 Gefährdete Hierarchien? Erotik jenseits von Standesgrenzen in den Novellen Matteo Bandellos | 131 | ||
| 9.1 Die anthropologische Neuorientierung in Bandellos Novellen: das faktische Primat der Affektivität gegenüber den Postulaten von Vernunft und Moral | 131 | ||
| 9.2 Das amouröse Überschreiten der Standesgrenzen und seine meist destruktiven Folgen | 134 | ||
| 9.3 Das Problem der die Standesgrenzen ignorierenden Liebesbeziehungen in zwei exponierten Novellen: eine tragisch endende Beziehung und der weibliche Anspruch auf einen rechtlich abgesicherten Wandel sozialer Hierarchien (I,42) im Unterschied zu einer dauerhaft glückenden, doch im Zuhörerkreis skeptisch beurteilten Verbindung (II,40) | 138 | ||
| 9.4 Die Diskrepanz von extradiegetischer Anschauungsweise und konkretem Erzählinhalt: der Topos vom Sieg der Affekte über die Vernunft und das Entstehen sozial nicht beherrschbarer Interaktionsformen | 142 | ||
| 9.5 Die Novellen als Gegenpol zur idealisierten Sonderwelt der Widmungsbriefe: das begrenzte Gewicht der Standesgrenzen angesichts einer als historisch invariant betrachteten und negativen Anthropologie | 145 | ||
| 10 Ripetizione e trasformazione. La novella „La Fiancée du Roi de Garbe“ di La Fontaine e la sua base decameroniana | 147 | ||
| 10.1 I „Contes et nouvelles en vers“ e i loro modelli italiani anteriori | 147 | ||
| 10.2 Alatiel e Alaciel: la ripetizione selettiva di La Fontaine | 148 | ||
| 10.3 Il diverso modellamento della protagonista in Boccaccio e in La Fontaine: i parametri divergenti dell’ironia narrativa e della dissimulazione femminile | 150 | ||
| 10.4 Lo scopo didattico di La Fontaine: un insegnamento di saggezza pratica | 155 | ||
| 10.5 Il nucleo comune delle due novelle: una determinata antropologia dell’erotismo femminile | 157 | ||
| 11 «Immediatezza» e «naturalità» nel „Novellino“ di Masuccio Salernitano: la misoginia come esempio | 161 | ||
| 11.1 Il pensiero topico di Masuccio: l’imperfezione innata delle donne e la differenza antropologica tra uomo e donna | 161 | ||
| 11.2 La misoginia generica di Masuccio: le donne del „Novellino“ a confronto con le donne in Bandello e in Boccaccio | 165 | ||
| 11.3 La novella XXI e il parossismo della vena antifemminile | 169 | ||
| 11.4 L’ostinazione emotiva e il furore verbale contro le donne: una „mise en abyme“ di insistenza tautologica | 170 | ||
| 11.5 Il commento alla novella XXX: «Masuccio» di fronte a una «brigata» di donne fautrici di una antropologia indifferenziata | 173 | ||
| 12 Il denaro e la Fortuna nel „Decameron“. Su alcune novelle della seconda giornata | 179 | ||
| 12.1 Il denaro e la Fortuna nel „Decameron“: due entità imponderabili | 179 | ||
| 12.2 L’intreccio di denaro, Fortuna e teleologia divina nell’avventura di Rinaldo d’Esti (Dec. II,2) | 181 | ||
| 12.3 Il denaro va per il suo verso come fa la Fortuna: le peripezie nella vita di Landolfo Rufolo („Dec“. II,4) | 184 | ||
| 12.4 La Fortuna coadiuvante del denaro simbolo della concretezza svanita: le vicissitudini economiche di Andreuccio da Perugia (Dec. II,5) | 186 | ||
| 12.5 Una antropologia sconcertante: la persona ridotta al suo valore economico. L’ingovernabilità del denaro e l’ingerenza della Fortuna maligna e benigna nel rapporto dei coniugi Bernabò e Zinervra („Dec“. II,9) | 189 | ||
| 12.6 Le scelte immorali in campo finanziario e l’atteggiamento equivoco della Fortuna: cadute e riprese economiche di una famiglia ghibellina di Firenze („Dec“. II,3) | 193 | ||
| 12.7 La Fortuna: antagonista del denaro oppure il suo „alter ego“ | 197 | ||
| 13 Verso la nascita dell’individuo moderno. Simulazione e dissimulazione nel „Decameron“ | 199 | ||
| 13.1 La valutazione negativa del fenomeno di simulazione / dissimulazione nell’Antichità e nel Medioevo. L’abbozzo di una antropologia diversa nel „Decameron“ | 199 | ||
| 13.2 L’arte del fingere nelle decisioni immediate: il suo carattere di disposizione interiore e il suo orientamento verso un nuovo modello antropologico | 201 | ||
| 13.3 Simulazione e dissimulazione quali caratteristiche di una individualità inedita | 205 | ||
| 13.4 Le forme para-menzognere e la loro parziale giustificazione sulla scia del „cor duplex“ agostiniano | 208 | ||
| 13.5 La mistificazione ossia l’autonomia della „ratio“ pratica nei confronti della „ratio“ speculativa: Boccaccio seguace non ortodosso di Tommaso d’Aquino | 213 | ||
| 14 Wie Frauen der Prozess gemacht wird. Signifikante Rechtsfälle in Bandellos Novellistik | 217 | ||
| 14.1 Bandellos Novellen im Zeichen des „guasto mondo“ vor dem Hintergrund der bestehenden Rechtsorgane | 217 | ||
| 14.2 Die bedeutsame Rolle der vor Gericht stehenden Frauen und das Erzeugen von „stupore e meraviglia“ | 220 | ||
| 14.3 Markante Gerichtsverfahren mit Todesurteilen für skrupellose und ingeniöse Mörderinnen unterschiedlicher Motivation: die Justiz als Beglaubigungsinstanz eines anthropologischen Vorverständnisses | 223 | ||
| 14.4 Der Prozess gegen die Valencianerin Violante: seine Besonderheit und die Kongruenz von kodifiziertem Recht und Gerechtigkeitsempfinden | 227 | ||
| 14.5 Die Verflechtung von Rechtsnovellen und Widmungsbriefen: aristokratische Zirkel als heuristische Rechtsinstanzen | 231 | ||
| Nachweise der Erstveröffentlichungen der Beiträge | 237 | ||
| Namenregister | 239 | ||
| Begriffsregister | 247 | ||
| Literaturverzeichnis | 253 | ||
| Rückumschlag | 272 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish