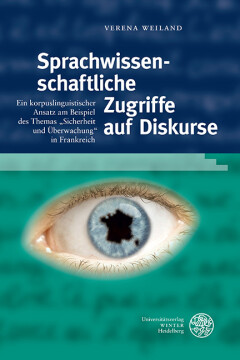
BUCH
Sprachwissenschaftliche Zugriffe auf Diskurse
Ein korpuslinguistischer Ansatz am Beispiel des Themas „Sicherheit und Überwachung“ in Frankreich
Studia Romanica, Bd. 220
2020
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Diskurslinguistik ist in der Sprachwissenschaft inzwischen ein etablierter Forschungsbereich. In der deutschsprachigen Romanistik wird bisher hauptsächlich auf diskurstheoretische Arbeiten aus der Germanistik zurückgegriffen. Diese wiederum proklamiert zwar häufig eine ‚Diskurslinguistik nach Foucault‘, lässt weitere Herangehensweisen aus dem frankophonen Sprachraum jedoch unbeachtet. Die vorliegende Arbeit zeigt Denkschulen sowie Ansätze auf, die in Frankreich, der Schweiz sowie in Belgien eine hohe Rezeption und teils paradigmatische Wirkung erreicht haben. Der Schwerpunkt liegt auf den sprachlichen Elementen, die jeweils aufgenommen werden, und auf methodologischen Aspekten. Anhand des französischen Diskurses zum Thema „Sicherheit und Überwachung“ werden die Zusammenhänge und Komplementarität verschiedener Ansätze aufgezeigt und es wird dargelegt, wie deren Kombination – auch unter Berücksichtigung einer Herangehensweise aus der Germanistik – als umfassende Methodologie verstanden werden kann.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| 1 Einleitung | 15 | ||
| 1.1 Grundzüge eines theoretischen Rahmens: ‚Diskurs und Diskursanalyse‘ | 16 | ||
| 1.2 Konstituenten von Diskursen und Diskursanalysen | 21 | ||
| 1.3 Aufbau der Arbeit | 23 | ||
| 2 Charakteristika der Diskursanalyse in Frankreich und in der deutschsprachigen Französistik | 25 | ||
| 2.1 1969: Das „große Jahr“ der Diskursanalyse | 27 | ||
| 2.1.1 Rückgriff auf Zellig S. Harris’ ‚Discourse Analysis‘ | 27 | ||
| 2.1.2 Michel Pêcheux’ ‚Automatische Diskursanalyse‘ | 30 | ||
| 2.1.3 Michel Foucault: Aussagen in ‚diskursiven Formationen‘ | 31 | ||
| 2.2 Überwindung des strukturalistischen Verständnisses | 34 | ||
| 2.3 Hinwendung zur Unabgeschlossenheit und Heterogenität von Diskursen | 35 | ||
| 2.4 Diskurse als interdiskursive Beziehungsgeflechte | 37 | ||
| 2.5 Schwerpunkte und Anwendungsaspekte diskurslinguistischer Untersuchungen | 42 | ||
| 2.5.1 Zur Herausbildung einiger thematischer Schwerpunkte | 43 | ||
| 2.5.2 Zum Verhältnis von Diskurstraditionenforschung und Diskursanalyse | 45 | ||
| 2.5.2.1 Diskurstraditionelle Fragestellungen in diskurslinguistischen Arbeiten der deutschsprachigen Romanistik | 46 | ||
| 2.5.2.2 Zur Frage des Genre / ‚genre‘ | 47 | ||
| 2.5.2.3 Diskurstraditionen im Bereich der diskursiven Analyse von Pressetexten | 51 | ||
| 2.5.2.4 Diskurstraditionen im Internet | 54 | ||
| 2.5.3 Quantitative Methoden in der Diskurslinguistik | 55 | ||
| 3 Herangehensweisen zur Analyse konstitutiver Diskurselemente | 61 | ||
| 3.1 Vorüberlegungen | 61 | ||
| 3.1.1 Thematische Bezüge und sprachliche Zugriffe auf ein Ereignis (‚événement‘) | 61 | ||
| 3.1.2 Akteure und Stimmen im Diskurs | 64 | ||
| 3.1.3 Wissensvoraussetzungen | 64 | ||
| 3.2 Diskursive Ereignisse | 65 | ||
| 3.2.1 Das Ereignis als Untersuchungsgegenstand in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen | 66 | ||
| 3.2.2 Diskurslinguistische Ansätze zur Analyse von Ereignissen | 71 | ||
| 3.2.2.1 ‚Diskursive Momente‘ als diskurslinguistische Analyseeinheit | 72 | ||
| 3.2.2.2 Analyse von Ereignisbenennungen mittels des ‚lexikalischdiskursiven Profils | 77 | ||
| 3.2.2.3 Analyse und Kategorisierung nominaler Ausdrücke zur Ereignisbenennung | 79 | ||
| 3.2.2.4 Analyse von Ereignissen auf Grundlage von Formeln | 83 | ||
| 3.2.2.5 Fazit: Linguistische Zugriffsweisen auf diskursive Ereignisse | 86 | ||
| 3.3 Multiperspektivität im Diskurs: Stimmen und Akteure | 87 | ||
| 3.3.1 Polyphonie: Stimmen auf unterschiedlichen Ebenen | 88 | ||
| 3.3.1.1 Selbstdarstellung: das ‚Ethos‘ als diskurslinguistisches Analysekonzept | 90 | ||
| 3.3.1.2 Darstellung des Geschehenen: Die ‚Perspektive‘ als diskurslinguistisches Analysekonzept | 91 | ||
| 3.3.2 Konflikte im Diskurs | 95 | ||
| 3.3.2.1 Agonalität | 96 | ||
| 3.3.2.2 Argumentation | 99 | ||
| 3.3.3 Diskussion: Polyphonie und Diskursakteure | 101 | ||
| 3.4 Wissensvoraussetzungen | 103 | ||
| 3.4.1 Unvollständige Strukturen | 103 | ||
| 3.4.2 Prädiskursives | 104 | ||
| 3.4.3 Kognitive Aspekte | 105 | ||
| 3.5 Zwischenfazit: Analyseelemente und -kategorien | 108 | ||
| 4 Analyseebenen als linguistische Zugriffsweisen auf Diskurse | 109 | ||
| 4.1 Mehrebenenanalyse in der Diskurslinguistik | 109 | ||
| 4.1.1 Diskurslinguistische Mehr-Ebenen-Analyse (‚DIMEAN‘) | 111 | ||
| 4.1.2 Das Genfer Modell zur modularen Analyse der Organisation von Texten | 113 | ||
| 4.2 Konzipierung | 116 | ||
| 4.2.1 Die außerdiskursive Ebene | 119 | ||
| 4.2.2 Die prädiskursive Ebene | 119 | ||
| 4.2.3 Die äußerungsszenographische Ebene | 121 | ||
| 4.2.4 Die thematische Ebene | 123 | ||
| 4.2.5 Die perspektivischen Ebenen: Agonalität, Polyphonie, Argumentation | 125 | ||
| 4.2.5.1 Die agonale Ebene | 126 | ||
| 4.2.5.2 Die polyphone Ebene | 128 | ||
| 4.2.5.3 Die argumentative Ebene | 130 | ||
| 4.2.6 Die extensive Ebene | 132 | ||
| 4.2.7 Zusammenführung der Analyseebenen | 133 | ||
| 4.2.8 Zwischenfazit: Analyseebenen | 138 | ||
| 5 Kriterien der Korpuserstellung und -analyse | 139 | ||
| 5.1 Erstellung der Korpora | 140 | ||
| 5.1.1 Auswahl der Suchausdrücke zur Korpuserstellung | 141 | ||
| 5.1.1.1 Grundsätzliche Herausforderungen bei der Zusammenstellung der Suchsyntax | 142 | ||
| 5.1.1.2 Vorstudie zur Bestimmung der Suchsyntax | 144 | ||
| 5.1.2 Auswahl der Quellen für die Korpuserstellung | 149 | ||
| 5.1.2.1 Tageszeitungen und Zeitschriften | 149 | ||
| 5.1.2.2 Radio | 153 | ||
| 5.1.2.3 Weblogs | 154 | ||
| 5.2 Quantitative Herangehensweisen in der Diskussion | 156 | ||
| 5.2.1 Plädoyer für eine Kombination qualitativer und quantitativer Methoden | 156 | ||
| 5.2.2 Vertiefung: Analysekategorien und Computerprogramme für die quantitative Analyse | 158 | ||
| 5.3 Zwischenfazit: Analyseweise und Untersuchungskorpus | 162 | ||
| 6 Korpuslinguistisch motivierte Diskursanalyse | 165 | ||
| 6.1 Zur Relevanz der Korpusunterteilung für die Analyse | 166 | ||
| 6.2 Analyse auf der außerdiskursiven Ebene | 169 | ||
| 6.3 Analyse auf der prädiskursiven Ebene | 172 | ||
| 6.3.1 Vorbemerkung zur analytischen Vorgehensweise | 173 | ||
| 6.3.2 Metaphern | 173 | ||
| 6.3.3 Antithesen | 178 | ||
| 6.3.4 Vergleichsmomente in den Texten der Weblogs | 181 | ||
| 6.4 Analyse auf der äußerungsszenographischen Ebene | 182 | ||
| 6.4.1 Vorbemerkung zur Analyse der äußerungsszenographischen Ebene in umfangreichen Korpora | 183 | ||
| 6.4.2 Äußerungsszenographische Aspekte anhand des agonalen Zentrums ›Frankreich befindet sich im Krieg‹ vs. ›Es ist nicht angemessen, von ‚Krieg‘ zu sprechen | 184 | ||
| 6.4.3 Vergleichsmomente in den Texten der Weblogs und im Radio- Onlineportal | 189 | ||
| 6.4.3.1 Weblogs | 190 | ||
| 6.4.3.2 Radio | 192 | ||
| 6.5 Analyse auf der thematischen Ebene | 193 | ||
| 6.5.1 Offenlegen thematischer Aspekte auf Grundlage von Wort- und Schlüsselwortlisten | 194 | ||
| 6.5.1.1 Vorbemerkung zur analytischen Vorgehensweise | 195 | ||
| 6.5.1.2 Problematisierung der Auswertung von Wortlisten als Einstieg in die thematische Ebene | 196 | ||
| 6.5.1.3 Auswertung der Schlüsselwortlisten | 200 | ||
| 6.5.2 Analyse eines diskursiven Ereignisses auf der thematischen Ebene | 208 | ||
| 6.5.2.1 Vorbemerkung zur Abfolge der Analyseschritte | 209 | ||
| 6.5.2.2 Beispielhafte Frequenzanalyse eines Ereigniswortes | 210 | ||
| 6.5.2.3 Analyse des diskursiven Moments unter Berücksichtigung verschiedener Ereigniswörter | 213 | ||
| 6.5.3 Vergleichsmomente in den Texten der Weblogs und im Radio- Onlineportal | 218 | ||
| 6.5.3.1 Weblogs | 219 | ||
| 6.5.3.2 Radio | 220 | ||
| 6.6 Analyse auf den perspektivischen Ebenen | 220 | ||
| 6.6.1 Zusammenführung: Agonalität, Polyphonie und Argumentation als perspektivische Ebenen | 220 | ||
| 6.6.2 Analyse auf der agonalen Ebene | 222 | ||
| 6.6.2.1 Konstituierung diverser agonaler Zentren auf Grundlage von Kollokationsprofilen, Subthemen und handlungsleitenden Konzepten | 223 | ||
| 6.6.2.2 Vertiefung: Das agonale Zentrum ›Frankreich befindet sich im Krieg‹ vs. ›Es ist nicht angemessen, von ‚Krieg‘ zu sprechen | 232 | ||
| 6.6.2.3 Vergleichsmomente in den Texten der Weblogs und im Radio-Onlineportal | 234 | ||
| 6.6.3 Analyse auf der polyphonen Ebene | 235 | ||
| 6.6.3.1 Grenzen quantitativ basierter Herangehensweisen: Analysen ohne besondere Indikatoren | 236 | ||
| 6.6.3.2 Analysen ausgehend von agonalen Zentren und spezifischen Autosemantika | 241 | ||
| 6.6.3.2.1 Enunziative Heterogenität | 241 | ||
| 6.6.3.2.2 Neutralität, Evidenzialität und enunziatives Löschen | 245 | ||
| 6.6.3.2.3 Vertiefung: Das agonale Zentrum ›Frankreich befindet sich im Krieg‹ vs. ›Es ist nicht angemessen, von ‚Krieg‘ zu sprechen | 247 | ||
| 6.6.3.3 Vergleichsmomente in den Texten der Weblogs und im Radio-Onlineportal | 250 | ||
| 6.6.3.3.1 Weblogs | 250 | ||
| 6.6.3.3.2 Radio | 254 | ||
| 6.6.4 Analyse auf der argumentativen Ebene | 255 | ||
| 6.6.4.1 Argumentation mittels perspektivierender Autosemantika | 255 | ||
| 6.6.4.2 Spezifika der Analyse argumentativer Strukturen in Diskursen | 258 | ||
| 6.6.4.3 Vertiefung: Das agonale Zentrum ›Frankreich befindet sich im Krieg‹ vs. ›Es ist nicht angemessen, von Krieg zu sprechen | 261 | ||
| 6.6.4.4 Vergleichsmomente in den Texten der Weblogs und im Radio-Onlineportal | 265 | ||
| 6.6.4.4.1 Weblogs | 265 | ||
| 6.6.4.4.2 Radio | 267 | ||
| 6.7 Analyse auf der extensiven Ebene | 268 | ||
| 6.7.1 Analyse der extensiven Ebene in Bezug auf Ereignisse | 268 | ||
| 6.7.2 Skizzierung der Suche und Wahl eines Ereigniswortes im Diskursverlauf | 272 | ||
| 6.7.3 Frames als linguistische Analysekategorie | 274 | ||
| 6.7.4 Vergleichsmomente in den Texten der Weblogs und im Radio- Onlineportal | 283 | ||
| 6.8 Zusammenführung | 284 | ||
| 7 Fazit und Forschungsdesiderata | 287 | ||
| 7.1 Zusammenschau: Interdependenzen der Analyseebenen für Diskurse | 288 | ||
| 7.2 Ausblick und Desiderata | 292 | ||
| Literaturverzeichnis | 293 | ||
| Abbildungsverzeichnis | 323 | ||
| Tabellenverzeichnis | 325 | ||
| Anhang | 327 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish